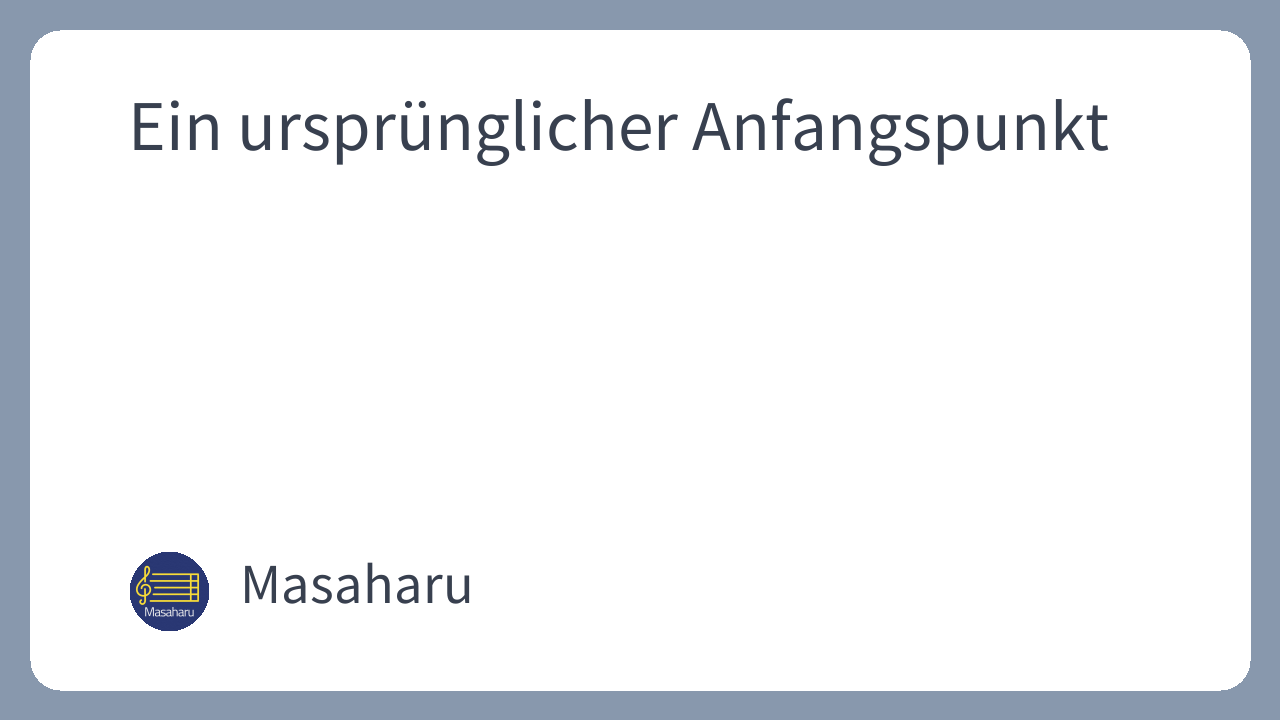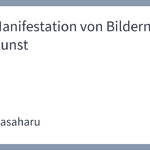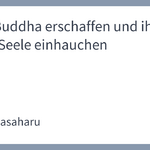(Ursprünglich veröffentlicht am 26. April 2007)
Eines meiner Lieblingsspiele als Kind war das Bauen mit LEGO-Steinen. Heute möchte ich ein wenig in diesen Erinnerungen schwelgen.
Manchmal spielte ich mit Freunden, die denselben Geschmack hatten, aber meistens war ich ganz für mich allein, versunken in mein Spiel.
„Ich baue ein Haus“ oder „Es soll ein Bahnhof mit Zug sein“ oder „Ein Raumschiff!“ Solche vagen Ideen hatte ich im Kopf, während ich zu bauen begann.
Was mich damals faszinierte, war, wie sich die Formen unter meinen Händen entwickelten – oft über meine ursprüngliche Vorstellung hinaus. Dieses Erstaunen und das Eintauchen in den kreativen Fluss war pures Glück.
Vor mir entstand etwas, das ich mir allein mit meiner Vorstellungskraft nie so hätte ausmalen können. Dieser Moment brachte ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit.
Von der Vorstellung zur Gestaltung zur Wirklichkeit – dieser Sprung der Erkenntnis war das Wertvolle an der Erfahrung mit den Steinen.
Wenn mich jemand mittendrin fragte: „Was baust du da?“, hatte ich selten eine Antwort. Diese Frage brachte mich aus dem kreativen Fluss, ich empfand sie als unangenehm.
Denn ich wusste selbst noch nicht genau, was ich baute. Ich folgte nur dem inneren Wunsch, etwas noch Unsichtbares mit meinen Händen sichtbar zu machen.
Heute glaube ich, dass ich mich schämte, weil ich mich mit meinem rohen, ungeschützten Wunsch konfrontiert sah.
Am meisten erinnere ich mich an ein „Schiff“ oder eine „künstliche Insel“. Doch es war kein Schiff im klassischen Sinn, sondern mehr eine schwimmende Insel. Später baute ich dann oft einfach „Inseln“ – oft beweglich, aus irgendeinem Grund.
Diese Konstrukte trennten klar zwischen Innen (der Insel) und Außen (dem Meer). Ich baute Mauern, Gebäude und auch Erweiterungen durch Landaufschüttungen.
Das „Meer“ war dabei nicht einfach Hintergrund wie in westlicher Malerei, sondern eher ein symbolisches Nichts wie in der japanischen Kunst – ein Leerenraum.
Die Insel war also kein Teil der Umgebung, sondern ein autonomes Gebilde, das sich selbst formte und entwickelte.
Es gab keine vorgegebene Struktur. Nur eines war fast immer da: ein Hafen irgendwo.
Oft veränderte ich spontan Formen, oder stellte bewusst Gebäude an seltsame Orte, losgelöst von Alltagslogik. Die Inseln wuchsen wie von selbst durch meine Hände.
Beim Schreiben merke ich: Das ist wie beim Komponieren. Auch dort entsteht die Form im Dialog zwischen Klangvorstellung und Realität.
Es ist nicht wie beim vorgeplanten Komponieren mit festen Formen oder dem Füllen von vorgegebenen Songstrukturen.
Es ist eher so, dass sich durch das Suchen nach Inhalten auch eine neue Form ergibt – wie bei Huhn und Ei.
(Vielleicht ist es besser, dies nicht als musikalische Form im klassischen Sinne zu begreifen, sondern als Formbildung im gestalthaft-kreativen Sinne. Muss noch weiter gedacht werden.)
Wenn man vergisst, dass Form nicht vorausbesteht, verwendet man sie leicht als Schablone. Das habe ich oft getan.
So wie beim Spielen ein fade Kopie entstand, wenn ich ein reales Objekt nachbaute, fühlt sich auch eine Komposition leer an, wenn ihre Form nicht organisch gewachsen ist.
Ich möchte im engen Dialog mit dem entstehenden Werk bleiben und seine natürliche Entwicklung erspüren.
Vielleicht habe ich hier einen Teil dessen gefunden, was für mich „zum Anfang zurückkehren“ bedeutet.