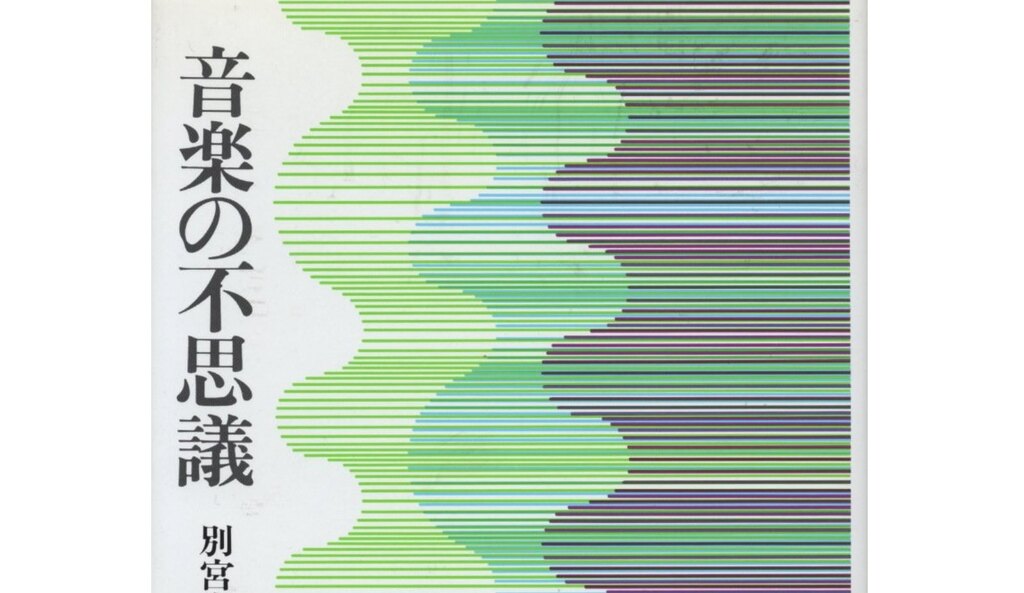(Erstveröffentlichung am 8. April 2002)
Es scheint, dass Musik seit alters her oft in engem Vergleich mit Architektur diskutiert wurde, und der Satz im Titel, „Architektur ist gefrorene Musik“, wird in diesem Buch als Beispiel dafür vorgestellt. Ich finde diesen poetischen Ausdruck ziemlich wunderbar; wie empfinden Sie ihn?
Dieser aufschlussreiche Satz ist dafür bekannt, dass er häufig von Iannis Xenakis zitiert wurde, einem griechischen Komponisten, der auch Architekt war. Genau genommen haben vor Xenakis bereits der deutsche Romantik-Philosoph Schelling und der Literaturriese Goethe ähnliche Ausdrücke verwendet. Dieser Satz jedoch, der die beiden scheinbar so unterschiedlichen Kunstformen Architektur und Musik verbindet, hat die Vorstellungskraft vieler Kreativer angeregt.
Worin also ähneln sich Architektur und Musik? Ich glaube, dies wird deutlich, wenn wir „Schwerkraft“ als Schlüsselwort betrachten. Lassen Sie uns dies gemeinsam mit dem Autor untersuchen.
Betrachten wir zunächst die Architektur. Es mag abrupt erscheinen, aber was würde passieren, wenn man Steintürme, gotische Kathedralen oder japanische Schreine und Tempel auf den Kopf stellen würde? In dem Moment, in dem man versuchen würde, sie in diesem Zustand zu bewegen, würden sie wahrscheinlich einstürzen, was es unmöglich machen würde, ihre Form zu bewahren. Mit anderen Worten, Architektur ist grundsätzlich mit dem Konzept einer Oben-Unten-Beziehung verbunden.
Was ist diese „Oben-Unten-Beziehung“? Sie bezieht sich auf „die Richtung, in die die Schwerkraft wirkt“.
Baukunst ist Ausdruck des Kampfes des Menschen mit der Schwerkraft, und der Ordnung der Baukunst liegt die Ordnung der Schwerkraft zugrunde, die Ordnung der mechanischen Gesetze, wie mit ihr umzugehen ist. (S. 172)
In der gotischen Architektur werden unter Verwendung der Weisheit der Bogenform riesige Bauwerke geschaffen, um der an sich unwiderstehlichen Kraft der „Schwerkraft“ entgegenzuwirken. Der Autor legt nahe, dass diejenigen, die diese Bauwerke betrachten, nicht nur von ihrer schieren Größe überwältigt werden, sondern auch durch das Nacherleben dieses Kampfes mit der Schwerkraft bewegt werden. Das Wesen der Existenz von Architektur und ihrer Schönheit liegt darin, wie die unteren Schichten die oberen Schichten tragen und wie diese wiederum von den unteren Schichten getragen werden.
Dies auf die Musik anwendend, äußert sich der Autor wie folgt:
Ein Klang folgt auf den anderen. Klänge fließen einer nach dem anderen und gipfeln in einem bestimmten Klang. Damit es Musik ist, muss der spätere Klang den Klang empfangen, der zuvor erklang, so wie die untere Schicht in der Architektur die obere Schicht empfängt. Oder, wenn er ihn nicht angemessen empfängt, entsteht eine Art klanglicher Impuls, und ein Klang, der stark genug ist, alles zu sammeln und fest zu empfangen, folgt später, wie ein Balken, der viele Säulen aufnimmt. So ist Musik aufgebaut. (S. 173)
Mit anderen Worten, was der Schwerkraft in der Architektur entspricht, ist die Zeit in der Musik. Wenn man ein Musikstück rückwärts vom Ende her hört, wird seine ursprüngliche Form nicht erkennbar. Was man hören würde, wäre wie ein Trümmerhaufen eines umgestürzten Gebäudes.
In der Architektur können große Strukturen durch Einfallsreichtum bei Vorrichtungen wie Bogenstrukturen für Stein und Fachwerk, Verbindungen und Balken für Holz geschaffen werden. Was ist mit der Musik? In ähnlicher Weise können große Strukturen durch die Erfindung von „Mechanismen“ geschaffen werden, die in der Lage sind, den Klangfluss an entscheidenden Punkten fest zu unterstützen.
Was ist dieser „Mechanismus“? Es ist etwas, von dem jeder, der auch nur eine geringe Ahnung von Musiktheorie hat, gehört hat: die „Dominantbewegung“. Sie wird manchmal auch „Auflösung vom Dominantakkord“ genannt. In der Geschichte der westlichen Musik war die Erfindung dieser „starken Holzverbindung“ ein epochales Ereignis, das den Bau großer musikalischer Architekturen ermöglichte.
Tatsächlich ist die Ausweitung des Maßstabs in der westlichen Musik größtenteils auf den Einfluss der Dominantbewegung zurückzuführen. Beispielsweise ist die Dominantbewegung für die Unterstützung der Struktur von Beethovens Symphonien unverzichtbar. Der Mechanismus hinter dem Gefühl, dass Musik kraftvoll durch die Zeit voranschreitet, ist hier zu finden. Natürlich gibt es heutzutage auch viel Musik, die sich nicht ausschließlich auf diesen „Mechanismus“ verlässt.
Es gibt eine Tendenz, das starke Gefühl des „Vorwärtsdrangs/Zeitgefühls“ der Dominantbewegung abzulehnen und es als unkultiviert oder langweilig zu betrachten. Aus einer fortschrittlich-historischen Perspektive werden auch Stimmen laut, die es als „altmodisch und schlecht“ bezeichnen. Welche Alternativen gibt es also zu diesem „Mechanismus“?
Eine davon ist eine „Veränderung des Werts von Struktur“, die sich von „zeitlichem Fortschreiten (Akkumulieren)“ hin zu „kontinuierlicher Veränderung“ bewegt. Es gibt Strukturen, bei denen der höchste Wert darin liegt, wie sich der Klang dieses Augenblicks von dem unterscheidet, was vorher war, und wie er sich weiter verändern wird.
Konkret kann man Musik nennen, die als „Onkyo-ha“ (klangfokussierte Schule) bezeichnet wird, und bestimmte Subgenres der Techno-Musik würden ebenfalls in diese Kategorie fallen. Weit ausgelegt, lässt sich diese Tendenz auch in mancher Popmusik beobachten. Minimal Music würde hier ebenfalls passen, obwohl es interessanter ist, sie aus der Perspektive der „Verräumlichung der musikalischen Zeit durch Wiederholung“ zu betrachten.
Nun, basierend auf diesen Ideen wäre es interessant, unserer Vorstellungskraft freien Lauf zu lassen: „Wenn wir die Existenz der Schwerkraft in der Musik ignorieren, das heißt, wenn wir eine musikalische Struktur in der Schwerelosigkeit schaffen würden, welche Art von Musik wäre möglich?“
Der Autor gibt an, dass dies in der Zwölftonmusik bereits geschehen ist. Tatsächlich spürt man beim Hören solcher Musik selten eine traditionelle Dominantbewegung. Und das Gefühl unbeschreiblicher Haltlosigkeit, das man beim Hören erfährt, könnte der Angst ähneln, in den schwerelosen Raum geworfen zu werden.
Die Betrachtung struktureller Mechanismen, die gerade in diesem Gefühl der Schwerelosigkeit wirksam werden können, könnte jedoch ein wichtiger Punkt zur Bereicherung der Palette kompositorischer Techniken sein.
Titel (Japanisch):『音楽の不思議』
Autor: 別宮 貞雄 (著)
ISBN : 4276200806
Verwandte Artikel