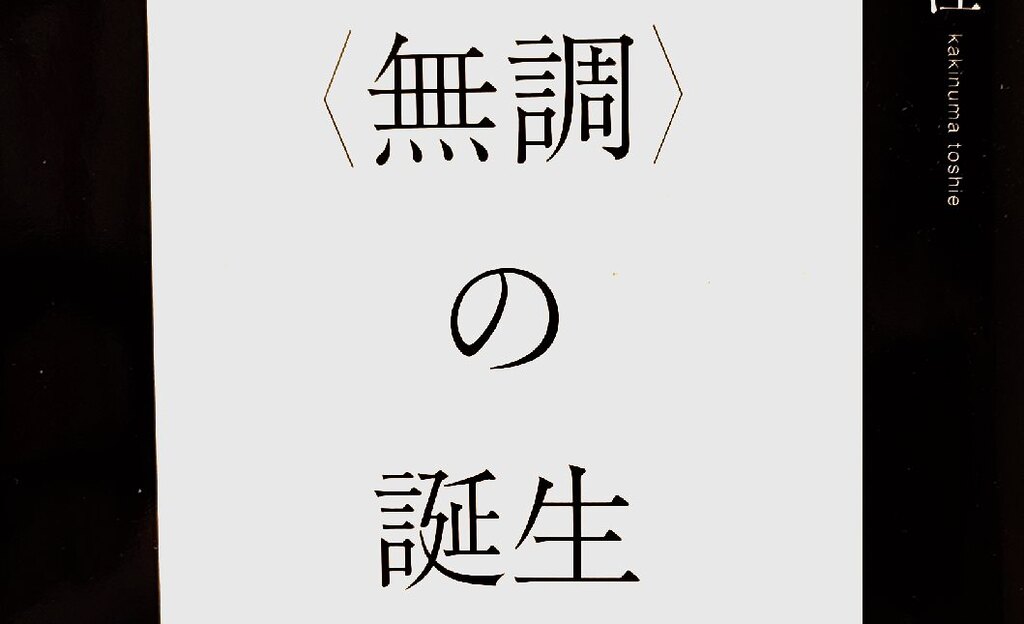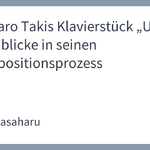Wenn Sie die Geschichte der Musik des 20. Jahrhunderts als eine lineare Erzählung gelernt haben, in der Wagners extremer Chromatik zum Zusammenbruch der Tonalität führte, woraufhin Schönberg die atonale Musik schuf, die sich zur Zwölftontechnik entwickelte, dann wird dieses Buch Ihre Sicht auf die Musikgeschichte grundlegend erschüttern und eine neue intellektuelle Begeisterung wecken.
Toshie Kakinumas Buch *„Die Geburt der Atonalität“: Die Zukunft der Musik in einer Zeit ohne Dominanten* stellt diesen „Mythos“ der Musikgeschichte, den viele von uns als selbstverständlich hingenommen haben, fundamental in Frage.
Das Buch beginnt mit einer ebenso einfachen wie bisher gemiedenen Frage: Woher stammt eigentlich das Wort „Atonalität“?
Überraschenderweise wurde es nicht von Schönberg selbst geprägt. Es entstand um 1906 aus den emotionalen Reaktionen von Zuhörern und Kritikern, die seine Werke als zu unverständlich empfanden und sie als „unmusikalisch“ abtaten. Es war im Grunde eher ein aus dem „Eindruck“ geborenes Wort.
Schönberg, der später als „Begründer der atonalen Musik“ bezeichnet werden sollte, lehnte diesen Begriff strikt ab. Er nannte seine eigene Musik „Pantonalität“ und vertrat die Auffassung, dass die Tonalität nicht verschwunden, sondern vielmehr erweitert worden sei, um alle Tonalitäten zu umfassen und eine neue, erweiterte Form der Tonalität zu schaffen. Dies war eine höchst originelle Philosophie, die einen umfassenderen musikalischen Zustand jenseits des Dualismus von Dur und Moll anstrebte.
Das Buch zeichnet den Ursprung dieses Begriffs akribisch nach und deckt so die Brüchigkeit der konventionellen, evolutionistischen Sichtweise der Musikgeschichte auf, die besagt: „Die tonale Musik brach zusammen, und danach entstand eine neue Musik namens Atonalität.“
Der eigentliche Kern des Buches geht jedoch über eine reine Neubewertung der Musiktheorie hinaus. Die Autorin zeigt mit scharfsinniger Analyse auf, wie das Konzept der „Atonalität“ mit außermusikalischen Bereichen wie Politik und Ethik verknüpft wurde.
Schönbergs damaliges Bestreben nach einer „Befreiung aus den Fesseln der Tonalität“ führte zu einem Diskurs von „Atonalität = Freiheit“ und „Atonalität = Revolution“, der durch die historischen Entwicklungen noch verstärkt wurde.
Insbesondere die Ablehnung der atonalen Musik als „entartete Musik“ durch die Nationalsozialisten führte paradoxerweise dazu, dass sich bei Musikern und Intellektuellen die Ansicht tief verwurzelte, dass „die von Hitler verachtete Musik die einzig wahrhaft aufrichtige und edle Kunst sein muss“.
Dahinter stand der einflussreiche Musikwissenschaftler und Philosoph Theodor W. Adorno. Als vehementer Verteidiger Schönbergs kritisierte er Komponisten, die weiterhin tonale Musik schrieben, sogar als „reaktionär“. Für Adorno war dies keine bloße Frage des musikalischen Geschmacks, sondern eine ethische Notwendigkeit für jemanden, der die Gräueltaten des Nationalsozialismus miterlebt hatte.
Es entsteht das Bild einer Zeit, in der viele Komponisten unter diesem politischen Druck gegen ihre eigentliche Überzeugung zur Zwölftontechnik „konvertierten“ oder einen spürbaren Zwang empfanden.
Dies ist eine ernüchternde Tatsache, die zeigt, wie untrennbar der musikalische Schöpfungsakt mit den Einflüssen seiner Zeit und Gesellschaft verbunden ist. Eine Anekdote, nach der der Cellist Julian Lloyd Webber später auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sinngemäß sagte, dass die „von Hitler verbotene ‚atonale Musik‘ nun paradoxerweise die tonale Musik verfolgt“, symbolisiert eindrücklich diese absurde Situation.
Wenn die traditionelle Geschichtsschreibung fehlerhaft ist, wie sollten wir dann die Musik des 20. Jahrhunderts neu bewerten? Die Autorin Toshie Kakinuma argumentiert: „Die Tonalität ist nicht zusammengebrochen, sie hat sich erweitert.“
Indem wir die Dichotomie „Atonalität versus Tonalität“ aufgeben, erkennen wir, dass bisher vernachlässigte „tonale“ Komponisten wie Sibelius und Britten die Möglichkeiten der Tonalität durch neue Techniken und zyklische Zeitstrukturen tatsächlich erweitert haben.
Auch die Analyse des frühen Penderecki, die zeigt, dass „selbst in scheinbar radikalen Avantgarde-Werken traditionelle Zeitstrukturen verborgen waren“, lehrt uns, wie wichtig es ist, über oberflächliche Stile hinauszublicken, um das Wesen eines Komponisten zu erfassen.
Dieses Buch zeichnet ein lebendiges Bild davon, wie die Musik des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus eine vielfältige und reiche Landschaft geformt hat, anstatt in einem einzigen historischen Hauptstrom zusammenzulaufen.
Wie wir gesehen haben, ist *„Die Geburt der Atonalität“* ein Buch des intellektuellen Abenteuers, das bestehendes Wissen neu zusammensetzt.
Die Lektüre dieses Buches wird Ihnen – sei es als Musikliebhaber, als Musikschaffender oder als Musikforscher – die Erfahrung ermöglichen, Ihr eigenes Verständnisfundament zu demontieren und neu aufzubauen.
Die Erzählweise, die der Frage nachgeht, ob es die „Atonalität“ überhaupt jemals gab, und dies auf eine umgekehrte, fast auf den Kopf gestellte Weise tut, verleiht dem Buch durch die detaillierte Schilderung der Autorin sogar den Charakter eines erstklassigen Krimis oder Dokumentarfilms.
Nach der Lektüre werden Sie die Musik des 20. Jahrhunderts und der Folgezeit mit anderen Augen hören und Inspiration für die Entwicklung neuer musikalischer Vorstellungen gewonnen haben.
Weitere Informationen zum Buch
Titel (Japanisch):『〈無調〉の誕生』
Autor: 柿沼 敏江 (著)
ISBN : 4276132053
Inhaltsverzeichnis von „Die Geburt der Atonalität“
- Prolog – Eine Zeit ohne Dominanten
- Kapitel 1: Was war „Atonalität“?
- Der Begriff Atonalität / Was ist Atonalität?
- Kapitel 2: Schönberg neu gelesen
- „Schönbergs Irrtum“ / Schönbergs Überzeugung / Monotonalität / Tonalität und Gender / Goethes Urpflanze
- Kapitel 3: Zwischen Atonalität und Tonalität
- Sich abzeichnende Tonalität / Tonalität in der Zwölftonmusik
- Kapitel 4: Die Rhetorik von Atonalität und Tonalität
- Von Nicht-Kunst zum Wahnsinn / Der Tod der Tonalität / Das Unheimliche / Freiheit und Befreiung / Atonalität und Revolution / Aufrichtigkeit und Ethik
- Kapitel 5: Kreneks „Konversion“ (Die Politik der Atonalität 1)
- Politische Kunst / Der Weg zu „Karl V.“ / Briefwechsel mit Adorno / „Karl V.“ und die Zwölftontechnik / Eine eigenständige Zwölftontechnik / Zwölftontechnik und Tonalität / Rotation und Modalität / Die Zwölftontechnik als Zufluchtsort
- Kapitel 6: Ein anderes Darmstadt (Die Politik der Atonalität 2)
- Kritik der Avantgarde-Musik / Die Stunde Null als Knotenpunkt / Hermann Heiß und die Zwölftontechnik / Herbert Eimert und die atonale Musik / Golychev, Hauer und der Serialismus / Das konstruierte Bild von Webern
- Intermezzo – Nicolas Nabokov und die „Atonalität“
- Kapitel 7: Die verborgene Strömung – Die Magie der oktatonischen Tonleiter
- Zwischen Chromatik und Diatonik / Die Ganztonleiter / Die oktatonische Tonleiter (Acht-Ton-Leiter) / Die vermittelnde Tonleiter / Oktatonik und Chromatik / Modi mit begrenzten Transpositionsmöglichkeiten / Oktatonik und japanische zeitgenössische Musik / Oktatonik und Spektralismus, Post-Spektralismus / Oktatonik und experimentelle Musik, Jazz
- Kapitel 8: Die Kreisläufe der Tonalität
- Kritik der Tonalität – Das Sibelius-Problem / Zeitgenössische Musik für das Volk – Hanns Eisler / Leichte Klassik (oder Tonalität als Dada) – Kurt Schwertsik / Die „Post“-Ästhetik (oder Musik als Postskriptum) – Valentin Silvestrov
- Kapitel 9: Die Welt, die durch Stimmung und Obertöne geschaffen wird
- Abweichung von der gleichstufigen Stimmung – Dritteltöne und Vierteltöne / Tonalität basierend auf reiner Stimmung – Shōhei Tanaka, Harry Partch / Ein Blick auf die Obertöne – Stockhausen und Ligeti / Spektralmusik und „Atonalität“ / Die Ausdehnung der Obertöne – Tenney, Radulescu u.a.
- Kapitel 10: Die Umlaufbahn der Zeit
- Was die Zeitachse erschafft / Spuren der Erzählung – Schönberg, Penderecki / Episodische Zeit – Satie, Strawinsky, Feldman / Die Geometrie der Zeit – Serialismus und Spektralmusik / Zyklische Zeit – Passacaglia und Quadratwurzel-Rhythmusstrukturen
- Epilog – Die zentrumlose Gegenwart
- Nachwort
- Bibliographie
- Anmerkungen
Über den Autor
Toshie Kakinuma
Geboren in der Präfektur Shizuoka. Promotion an der University of California, San Diego, mit einer Dissertation über Harry Partch.
Zu ihren Veröffentlichungen gehört „Amerikanische experimentelle Musik war ethnische Musik“ (Film Art Sha, 2005). Wichtige Übersetzungen umfassen John Cages „Silence“ (Suiseisha, 1996), „Fragen der kulturellen Identität“, herausgegeben von Stuart Hall et al. (Mitübersetzung, Omura Shoten, 2000), „Ausgewählte Werke von Alan Lomax“ (Misuzu Shobo, 2007) und Alex Ross‘ „The Rest Is Noise“ (Misuzu Shobo, 2010, Gewinner des Music Pen Club Japan Award) und „Listen to This“ (Misuzu Shobo, 2015).
Ihre Artikel umfassen „Die Aktivitäten der Lomaxes, Vater und Sohn: Vom ‚Volkslied‘ zur ‚Cantometrics‘“ in „Weltmusik aus der Perspektive des Volksliedes: Erkundung der Geomythen des Liedes“, herausgegeben von Shuhei Hosokawa (Minerva Shobo, 2012).
Sie war bis März 2019 Professorin an der Fakultät für Musik der Kyoto City University of Arts und ist derzeit emeritierte Professorin. Sie ist auch eine zertifizierte Meisterin (Natori) des „Ichigenkin“, einer einsaitigen Koto, die während der Edo-Zeit populär wurde und bis heute überliefert ist. (Zitat aus dem Buch)