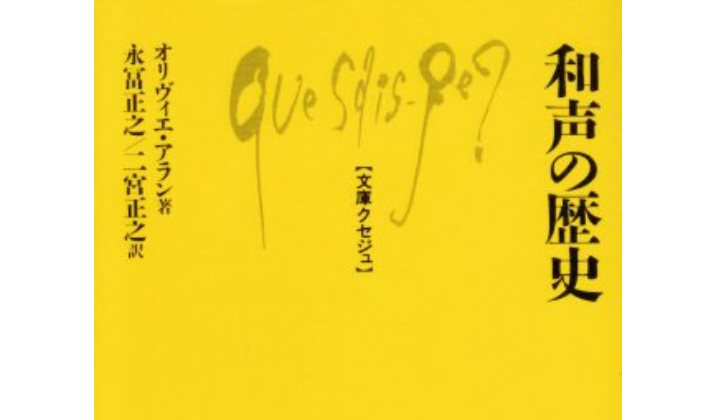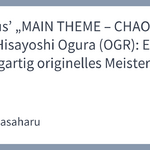(Erstveröffentlichung am 10. April 2002)
Harmonie, oder „Wasei“ auf Japanisch, wird mit „Einklang“ übersetzt. Dieses Buch betrachtet die Harmonie nicht nur im Rahmen der funktionalen Harmonie (tonale Harmonie), sondern verfolgt ihre Geschichte als etwas, das den Einklang repräsentiert und lenkt. Um es mit den Worten des Buches auszudrücken, es ist ein Versuch, die Harmonie als eine lange, durchgehende Linie zu betrachten, die sich durch die Musikgeschichte zieht.
Dieser historische Weg beginnt im 10. Jahrhundert, oder sogar um das 5. bis 6. Jahrhundert, wenn man den allgemeinen Überblick mit einbezieht. Die früheste Form der Harmonie, die man findet, ist sozusagen eine „Harmonie der Intervalle“, bei der Melodien parallel verlaufen und konstant eine Beziehung von Quarten und Quinten beibehalten. Von diesem Punkt aus beginnt das Buch die Geschichte der Harmonie zu verfolgen.
Die Seiten blättern sich schneller, wenn man den Abschnitt erreicht, der die Verwandlung von der Dämmerung der Tonalität zu ihrer Sättigung und Transzendenz darstellt. Dies geschieht, indem die individuellen Unterschiede zwischen den Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts herausgearbeitet werden – welche Elemente der tonalen Harmonie sie scharfsinnig vorantrieben und welche sie im Gegenteil vermieden. Das Tempo der Schrift, kombiniert mit dem Thema, macht diesen Teil zu einem fesselnden Abschnitt des Buches.
Zum Beispiel weist der Autor in einem Abschnitt mit dem Titel „Modalität und Tonalität“ darauf hin, dass viele russische und französische Komponisten des 19. Jahrhunderts die Modalität in die konventionelle (traditionelle) Tonalität integrierten und sie koexistieren ließen. Mit anderen Worten, die Modalität wurde als ein Element verwendet, um sich geschickt gegen die Unterdrückung durch die Tonalität zu wehren.
Dieses Streben nach Modalität war in Deutschland im selben Zeitraum nicht zu beobachten, wo ein durchgehender Chromatik sie über die Polytonalität schneller zu einem „Zustand der klanglichen Sättigung“ führte. In Frankreich und anderswo hingegen führte die Nutzung von Modi und Polymodalität dazu, dass das Aufkommen von Musik, die eine ähnliche Sättigung vermittelte, etwas später erfolgte.
Darüber hinaus nennt der Autor im folgenden Abschnitt „Die Dämmerung der Tonalität“ die „Verschleierung, Vergrabung und das Vergessen der Tonalität“ durch modale Materialien und Orchestrierungstechniken als ein harmonisches Merkmal von Debussys Werken. Er gibt an, dass Debussy, während sein harmonisches Gerüst (begrenzt) der modalen Tonalität folgte, die Harmonie durch die Verwendung von Polymodalität und Polytonalität bereicherte, indem er IV-, I- und V-Akkorde aus verschiedenen Modi entlehnte und die Bewegung des Leittons vermied. Dies, so sagt er, ebnete den Weg für Messiaens Techniken.
Nun, eine Sache, die exzellente Geschichtsbücher gemeinsam haben, ist ein geschicktes Gespür für die Perspektive bei der Fokussierung auf Personen und Ereignisse. Gerade wenn man denkt, sie hätten auf persönliche, winzige Details herangezoomt, ziehen sie den Leser sofort auf eine Höhe, die einen Überblick über soziale und kulturelle Situationen ermöglicht und einen vielschichtigen Eindruck hinterlässt.
In diesem Sinne – indem es eine „historische Erfahrung“ durch eine scheinbar schwindelerregende, aber kontrollierte und zurückhaltende Prosa vermittelt – ist es keine Übertreibung zu sagen, dass diese „Geschichte der Harmonie“ ein solches exzellentes Geschichtsbuch ist.
Es sei jedoch angemerkt, dass dieses Buch sich an eine ausgewählte Leserschaft richtet, da der Genuss halbiert wird, wenn man kein angemessenes Verständnis von Fachbegriffen hat, die sich auf Intervalle beziehen.
Somit ist dieses Buch sehr aufschlussreich und bietet einen Überblick darüber, „wie Komponisten jeder Epoche mit der Harmonie umgegangen sind und sie behandelt haben“. Wie oft gesagt wird: „Weise lernen aus der Geschichte, Narren aus der Erfahrung.“ Neben dem Lernen aus unseren täglichen musikalischen Aktivitäten sollten wir auch danach streben, viel aus der Geschichte der Musik zu lernen.
Weitere Informationen zum Buch
Titel (Japanisch):『和声の歴史 文庫クセジュ』
Autor: オリヴィエ アラン (著), 永冨 正之 (翻訳), 二宮 正之 (翻訳)
ISBN : 4560054487
Inhaltsverzeichnis von „Geschichte der Harmonie“
- Vorwort des Übersetzers / An den japanischen Leser / Vorwort
- Erstes Kapitel: Allgemeiner Überblick
- Notationen und Abkürzungen / Definition von Fachbegriffen / Modi / Akkorde
- Zweites Kapitel: Vom Intervall zum Akkord
- Ursprünge / 10. bis 12. Jahrhundert / 13. Jahrhundert / 14. Jahrhundert / 15. Jahrhundert
- Drittes Kapitel: Vom Akkord zur Tonalität – Harmonie der Renaissance (16.-17. Jahrhundert)
- Zusammenfassung / Konsolidierung der Modi zu Dur und Moll / Merkmale von Dur und Moll / Einfluss der Instrumentalmusik / Probleme der Stimmung / Generalbass und improvisierte Harmonie / Entwicklung / Musiker vor 1722
- Viertes Kapitel: Tonale Harmonie – Zwei Jahrhunderte gleichstufiger Musik, Erweiterung und Synthese (18.-19. Jahrhundert)
- Zusammenfassung / Neue Entdeckungen / Rameaus Theorie / Verschiedene Betrachtungen / Die Eroberung des gleichstufigen Raums / Fuge und tonaler Plan / Harmonie repräsentativer Musiker (18. Jh.) / Dasselbe (19. Jh.) / Modalität und Tonalität / Die Dämmerung der Tonalität
- Fünftes Kapitel: Sättigung und Transzendenz
- Endabrechnung – Die endgültige Rationalisierung der Tonhöhenharmonie / Aspekte der letzten Entwicklungsstufe / Sättigung des gleichstufigen Raums / Transzendenz der Reihe – Mikrotonalität
- Sechstes Kapitel: Ausblick
- Schlussfolgerung / Bibliographie
Über den Autor
Olivier Alain
Der Autor, Olivier Alain, wurde am 8. August 1918 in Saint-Germain-en-Laye bei Paris geboren. Er stammte aus einer Musikerfamilie; sein Vater war Organist, und seine Geschwister waren der früh verstorbene Komponist Jehan Alain und die Organistin Marie-Claire Alain. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat er in das Pariser Konservatorium ein, wo er in den Kompositions- und Analyseklassen erste Preise gewann. Er ist derzeit Direktor der École César-Franck und gleichzeitig als Musikkritiker für die Zeitung Le Figaro tätig und in vielen Bereichen aktiv. (Zitiert aus diesem Buch)