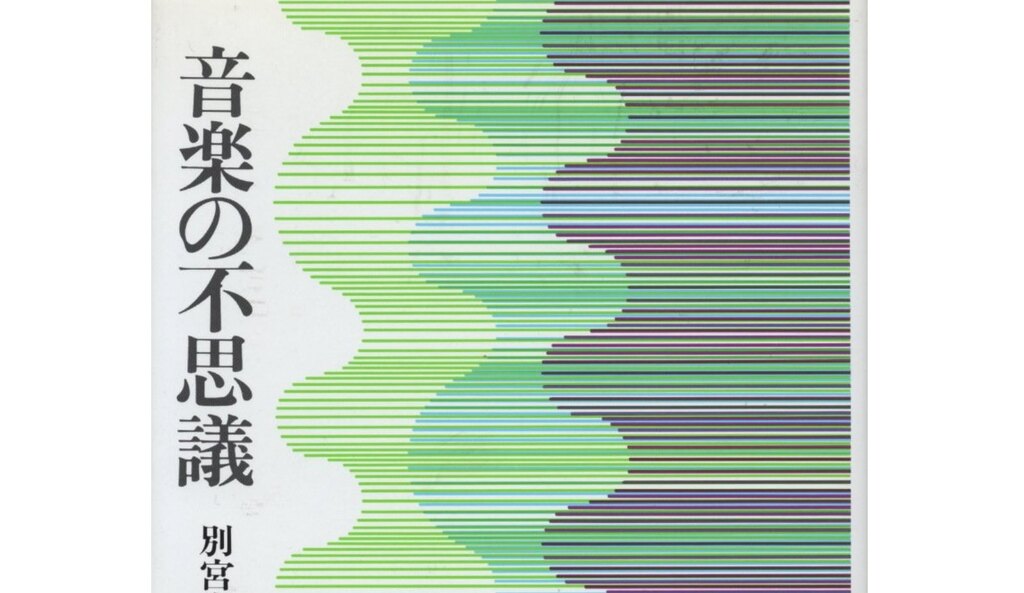(Erstveröffentlichung am 4. April 2002)
Der Autor, Sadao Bekku, schreibt in einem sehr klaren und einfachen Stil, und oft denke ich mir: „Wenn Sie das so sagen, stimmt das genau.“ Dieses Buch, „Ongaku no Fushigi“ (Die Wunder der Musik), vermittelt einen ähnlichen Eindruck. Vor allem ist der Autor selbst Komponist, und seine Worte strahlen ein auf Erfahrung gegründetes Selbstvertrauen aus.
Im zweiten Teil mit dem Titel „Auf der Suche nach Musik“ gibt es ein Kapitel namens „Nachahmung und Schöpfung in der Kunst“. Dies ist zweifellos eines jener Themen, die einem unweigerlich im Hinterkopf bleiben, nicht nur beim Komponieren, sondern bei jeder kreativen Tätigkeit.
Solange man wie besessen komponiert, werden solche Bedenken wahrscheinlich ignoriert, während Ergebnisse entstehen. Hält man jedoch inne und reflektiert, taucht es plötzlich im Bewusstsein auf: „Ist das, was ich tue, nicht bloße Nachahmung?“
Wie findet der Autor einen Ausgleich zwischen „Nachahmung und Schöpfung“? Nachdem er bekannte Sprüche aus allen Zeiten zitiert, wie „Der erste Schritt in der Kunst beginnt mit der Nachahmung“, und ihnen zustimmt, äußert er sich wie folgt:
Wenn man mit äußerster Ehrlichkeit der Idee nachginge, dass künstlerischer Wert durch Nachahmung erreicht werden kann, so würde dies meines Erachtens tatsächlich zur statistischen Untersuchung von Kunst mittels Computern und zur Erstellung von Anwendungsbeispielen führen. (Auslassung) Es ist jedoch nicht möglich, auf diese Weise überlegene Kunst zu schaffen. Mit anderen Worten, künstlerischer Wert ist nichts, was objektiv und universell existiert, noch ist er etwas, das Kunstwerke verkörpern und durch dessen Inkarnation sie sozusagen entstehen. Daher kann man sich dem Wert selbst nicht durch Nachahmung nähern. (S. 432)
Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert, selbst wenn man untersucht, „diese Art von Musik hat diese Art von Großartigkeit“ und dann versucht, „diese Art von Musik zu machen, um diese Art von Großartigkeit auszudrücken“.
Im Wesentlichen scheint ein Ansatz, Meisterwerke erschöpfend zu studieren, um zu ihrem Kern vorzudringen, in der Komposition bedeutungslos zu sein. Aber wenn das der Fall ist, worauf genau bezieht sich dann „Nachahmung“, wenn wir sagen, „es beginnt mit der Nachahmung“?
Seit alters her respektieren die traditionellen japanischen Künste (wie Kyogen und Bunraku) „Kata“ (etablierte Formen). In diesen Disziplinen ist die Einhaltung der Form von größter Bedeutung, aber um die höchste Stufe zu erreichen, wird vielmehr erwartet, dass man frei davon ist. Dies bezieht sich auf das Vorhandensein oder Fehlen von sogenanntem „Kihaku“ (innerer Geist oder Kraft).
Formen (Kata) können buchstäblich nachgeahmt werden, aber Geist (Kihaku) nicht. Oft schreit ein Trainer beim Sporttraining vielleicht: „Dir fehlt der Kampfgeist!“, aber der Athlet würde in diesem Moment nicht daran denken, den Kampfgeist eines anderen zu imitieren. Mehr noch, wenn er versuchen würde, ihn zu imitieren, würde genau diese Haltung als „mangelnder Kampfgeist“ angesehen werden.
Überträgt man dies auf die Komposition, könnte man sagen, dass der Inhalt aus dem Geist (Kihaku) geboren wird, während die Form durch Nachahmung geschliffen wird. In der Popmusik können Formen wie „Intro – A-Melodie (Strophe) – Bridge – Refrain“ oder in der klassischen Musik „Sonatenform“ oder „Rondoform“ sowie Tendenzen in der Instrumentierung und Klangfarbe durch Nachahmung besser verstanden werden.
Ich glaube jedoch, dass der Inhalt eines Liedes, das einem das Gefühl gibt „Das ist großartige Musik!“, genau das ist, was nicht nachgeahmt werden kann. Begegnungen mit temperamentvoller Musik gehen immer über das Verstehen hinaus. Dennoch ist die Untersuchung der Form eines solchen Liedes entscheidend, um zu verstehen, welche Art von Form für seinen Inhalt angemessen ist. Die als Analyse von Meisterwerken bekannte Tätigkeit sollte auf diese Weise verstanden werden.
Durch „Kata“ und „Kihaku“, „Form“ und „Inhalt“ äußert sich der Autor:
Was ist Form (Kata)? Sie ist eine Ordnung. Was ist Geist (Kihaku)? Es ist die Lebenskraft, die versucht, die feste Ordnung zu durchbrechen. Es ist der Wille zur Zerstörung. Die Sehnsucht nach Ordnung und die Freude an der Zerstörung – die Wahrheit dieser widersprüchlichen menschlichen Natur und ein Ort, an dem diese beiden Dinge, die in der realen Welt nur widersprüchlich sein können, auf wundersame Weise aufgehoben (transzendiert und vereint) werden – ist das nicht Kunst? (S. 436)
Er fährt fort und erklärt, dass man, wenn man den Grenzpunkt verliert, an dem Nachahmung wirksam ist, und versucht, den künstlerischen Wert selbst (in diesem Fall das „wundersame Gleichgewicht des Kampfes zwischen Geist und Form“) nachzuahmen, seine eigene Lebenskraft unterdrückt und zur Selbstzerstörung führt. Wenn man im Allgemeinen versucht, „dieses Meisterwerk nachzuahmen“, richtet sich der Fokus dieser Nachahmung dann nicht tendenziell auf „seinen Wert“? Und was wahrscheinlich daraus resultiert, ist etwas, dem die Lebenskraft des Schöpfers fehlt – ein sogenanntes „Lied ohne Originalität“.
Auf diese Weise erklärt der Autor klar den Zweck der Nachahmung, was nicht nachgeahmt werden kann, und damit auch den Wert der Musik. Die grobe Frage „Ist Nachahmung gut oder schlecht?“ kann verfeinert werden, indem man ihren wirksamen Bereich betrachtet. Und infolgedessen könnte man auf natürliche Weise erkennen, was „Kreativität“ wirklich ist.
Titel (Japanisch):『音楽の不思議』
Autor: 別宮 貞雄 (著)
ISBN : 4276200806
Verwandte Artikel