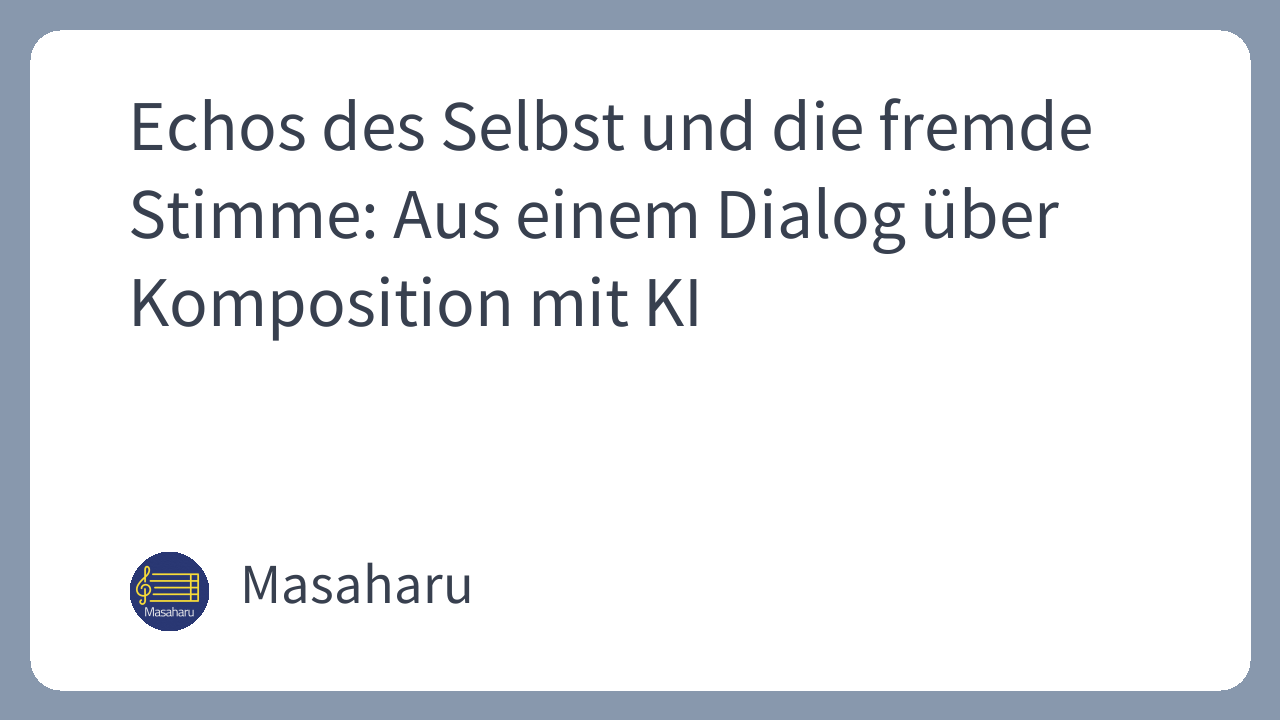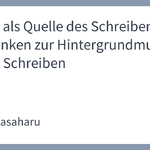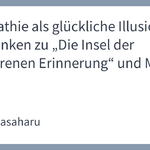Während sich die KI-Komposition rasant verbreitet, fragen wir Komponisten uns täglich, wie wir uns diesem neuen Werkzeug stellen sollen. Dieses Mal möchte ich meine Überlegungen vorantreiben, indem ich den Denkprozess entwirre, den die KI-Komposition für „mich als Komponist“ mit sich gebracht hat.
Bei dieser Überlegung habe ich den Fortschritt gemacht, indem ich eine KI (Gemini) als meinen Diskussionspartner eingesetzt habe. Es wurde ein Austausch in einer Umgebung, die aus menschlicher Sicht ein seltsames Gefühl hervorrief – über KI-Komposition mit einer KI zu sprechen.
Ist KI-Komposition „Komposition“? Ein Dialog zwischen Material und Sensibilität
Als ich zum ersten Mal ein KI-Kompositionswerkzeug wie Suno benutzte, fühlte ich: „Das ist eher dem Akt des ‚Diggens‘ von Musik (Erkunden/Suchen) ähnlich als dem Komponieren.“
Es fühlte sich weniger an, als ob ich Noten eine nach der anderen mit meinen eigenen Händen spinne, und mehr wie die Suche nach etwas, das mein Herz aus den unzähligen von der KI präsentierten Werken fesselt. Es schien die Freude an der Entdeckung zu haben, wie das Finden einer Lieblingsplatte unter den riesigen Werken auf dem Musikmarkt – eine Art Platten-Digging.
Diese Erfahrung veranlasste mich, die Definition des Aktes des „Komponierens“ in mir selbst zu hinterfragen. Bezieht sich Komposition überhaupt nur auf das Schaffen von allem aus dem Nichts?
Bei der Überlegung über die Antwort auf diese Frage habe ich die Tatsache wiedererkannt, dass ich selbst dem „Konstruieren“ als einem wichtigen Aspekt des kompositorischen Aktes große Bedeutung beimesse – mit anderen Worten, dass ich „komponiere, indem ich einen musikalischen Dialog mit Materialien führe“.
Das bedeutet, dass ich die von der KI erzeugten „fertigen Stücke“ sowie fragmentarische Phrasen, Rhythmen und harmonische/Akkordfolgen als einheitliche „Materialien“ betrachte, und mein natürlicher kompositorischer Akt darin besteht, zu überlegen, wie ich sie anordne und welchen Kontext ich ihnen gebe.
Zum Beispiel könnte man über einen bestimmten Teil eines KI-generierten Stücks Harmonien und Melodien legen, die ein Gefühl von Polymodalität hervorrufen, und dadurch einen neuen harmonischen Raum konstruieren. Dies würde wahrscheinlich dazu führen, den musikalischen Kontext (die Botschaft oder Geschichte, die auf ein bestimmtes Genre oder eine Epoche abzielt), den das ursprüngliche „fertige Stück der KI“ besaß, zu verfremden.
Ein solcher Prozess kann als Dialog zwischen Material und Sensibilität beschrieben werden. Durch diesen Dialog werden neue musikalische Bedeutungen und Erzählungen geboren.
In diesem Sinne ist die KI nicht nur eine „Technologie“, sondern könnte vielleicht als neuer „Dialogpartner“ in meinen eigenen kreativen Aktivitäten bezeichnet werden.
Wenn ich dieses Bild der „KI als Dialogpartner für meine Sensibilität“ betrachte, stelle ich fest, dass es gar nichts Besonderes ist, sondern etwas, das in der Musikgeschichte schon gesehen wurde.
In alten Zeiten gab es Mozarts musikalisches Würfelspiel; im 20. Jahrhundert John Cages Zufallsoperationen (aleatorische Musik) und die Sampling-Kultur des Hip-Hop – alles sind Begegnungen mit „unvorhersehbaren Elementen“, die von außen kommen. Die kompositorische KI ist ihre moderne Variante, eine Entität, die die Kontingenz statistisch rekonstruiert.
Innerhalb des Rahmens eines „Dialogs der Sensibilität“ mit „Material als dem Anderen“, das von außerhalb des Komponisten kommt, ist das Aufkommen der KI-Komposition selbst keine besondere Anomalie oder Singularität in der Musikgeschichte, sondern es wird auch der Aspekt sichtbar, dass es sich lediglich um eine zeitgenössische Variation dieses Trends handelt.
Wo die Existenz der Musik zu finden ist
Nun, die Existenz der KI als musikalischer Dialogpartner in der Komposition hängt mit meiner eigenen Musikanschauung zusammen – das heißt, meiner Haltung, die Existenz der Musik in „subjektiven Bedingungen“ statt in „objektiven Bedingungen“ zu suchen. Mit anderen Worten, ich vertrete die Position, dass „Musik in der Sensibilität des Hörers existiert“.
Das von einer kompositorischen KI präsentierte musikalische Material mag nichts weiter sein als das Ergebnis der statistischen Verarbeitung riesiger Datenmengen. Wenn ich jedoch in diesem Material subjektive Schönheit finde, entsteht dort die Bedeutung von ihm als „Musik“.
An dieser Stelle stellte die KI, mit der ich diskutierte, die Frage, welche Eigenschaften von einer kompositorischen KI verlangt werden, um einen „Dialog“ herzustellen.
Sollte ich zum Beispiel eine KI erwarten, die nicht nur zufällig vielfältige Materialien erzeugt, sondern auch meine musikalischen Vorlieben lernt und Antworten gibt, die den „Dialog“ lebendiger machen? Oder ist eine fremde Entität, die nach einer völlig anderen Logik operiert, für die Erlangung zufälliger und frischer Schöpfungen wünschenswerter?
Ich glaube, dass beide großes Potenzial haben. Wichtig ist letztlich nicht, was die KI produziert, sondern was ich in diesem Material finde.
Weiterhin fragt die KI:
- Was wäre, wenn eine kompositorische KI die vom Autor gefundene subjektive Schönheit statistisch lernt und beginnt, „musikalisches Material, das der Autor wahrscheinlich als schön empfinden würde“, auf einem vorhersagbareren Niveau zu erzeugen?
- Ist das dann kein Dialog mehr, sondern ist man in einem Raum gefangen, in dem die eigene Stimme nur von einer Wand widerhallt?
- Würde man in diesem Moment nicht ein Gefühl der Leere empfinden, wenn man merkt, dass man nur einem „Echo des Selbst“ lauscht – das heißt, „autistischer und in sich geschlossener Musik“?
Auf diese Frage habe ich den Gedanken geäußert, dass, ob man in einem „Echo des Selbst“ Wert findet, auch im Meta-Sinne als subjektives Urteil behandelt werden kann.
Es ist der Gedanke, dass es auch ein reizvoller Ausblick ist, zu einer Schöpfung zu gelangen, die eine „Form autistischer Perfektion“ als eine Form der Schöpfung darstellt, während man eine gewisse erhabene Schönheit in der Existenz eines so hochreinen „Echos des Selbst“ empfindet.
Damit ein solches „Echo des Selbst“ kreativ ist, wäre es wichtig, dass es sich um eine bewusst gewählte Schließung (Okklusion) handelt. Denn während Wiederholung aus unbewusster Trägheit zu Stagnation oder Regression führen kann, hat eine absichtliche Schließung das Potenzial, zu einer Läuterung der Form zu werden.
Das Werk(e) als Korpus in Bewegung
Als Antwort auf meine Gedanken stellte die KI die Frage: „Wie unterscheiden Sie zwischen einer Form autistischer Perfektion und kreativer Stagnation oder Regression?“
Daraufhin ging ich zur Prämisse der Frage selbst zurück und dachte: „Ist diese Unterscheidung überhaupt notwendig?“
Und ich entschied mich, diese Frage nicht unter dem Gesichtspunkt der Beurteilung der Qualität einzelner Werke anzugehen, sondern aus der Perspektive, sie alle als einen einzigen praktischen Fluss der „Geschichte des Autors“ zu betrachten – das heißt, als einen „Werkkorpus als ein Korpus in Bewegung“.
Indem ich einen Überblick über die Flugbahn der durch den Dialog mit der kompositorischen KI entstandenen musikalischen Werke gewinne, sollte ich in der Lage sein zu beobachten, wohin mein inneres Selbst steuert – den „Grad der Reinheit (Autismus)“.
Die Betrachtung dieses „Korpus in Bewegung“ wird eine unverzichtbare Meta-Selbstbewertung sein, um das eigene Wachstum und die Veränderungen objektiv zu beobachten und die Richtung für die nächste Schöpfung zu bestimmen.
Eindrücke
Durch die oben beschriebene Diskussion und Reflexion mit der KI habe ich das Gefühl, dass ich bei der Verbalisierung eines Aspekts meiner Herangehensweise an die kompositorische KI Fortschritte gemacht habe.
Mein vorläufiger Eindruck diesmal ist, dass die KI-Komposition das Potenzial hat, nicht nur ein bequemes Werkzeug zu sein, sondern auch ein „neuer Spiegel“, um die eigene kreative Philosophie zu hinterfragen und das eigene Innere zu erforschen.
Und ich glaube, dass dieser „Spiegel“ in gewissem Sinne etwas ist, das für den Autor allzu offensichtlich ist, aber bisher nicht klar verbalisiert wurde, und er einen zwingt, sich solchen „blinden Flecken“ zu stellen.
Abschließend sei noch angemerkt, dass es im Zusammenhang mit generativer KI verschiedene bestehende Probleme gibt, die ich hier nicht angesprochen habe (wie etwa die Herkunft und das Urheberrecht der Daten, aus denen die generative KI lernt, und Argumente gegen generative KI). Ich hatte jedoch das Gefühl, dass diese meine derzeitigen Fähigkeiten übersteigen, weshalb ich beschlossen habe, das Thema festzulegen und die Diskussion in diesem Artikel zu führen.