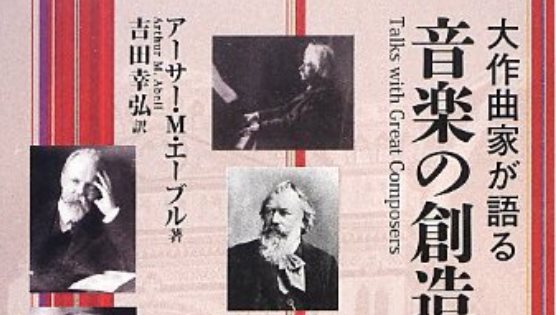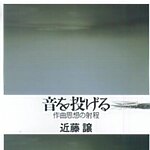(Erstveröffentlichung am 23. Januar 2009)
(*Dieses Buch ist eine überarbeitete und neu editierte Version von „Ich will dich lehren, was du tun sollst“. Der folgende Text wurde auf der Grundlage der früheren Ausgabe verfasst.)
Dieses Buch enthält wertvolle Interviews mit berühmten Komponisten des späten 19. Jahrhunderts wie Brahms, R. Strauss und Grieg, in denen sie nach „Inspiration“ gefragt werden.
Auf den ersten Blick mögen Inhalt und Ausdrucksweise nichts weiter als anachronistisch erscheinen. Es ist jedoch ein mühevolles Werk, das sich direkt mit der Frage auseinandersetzt, was im Inneren eines Komponisten vorgeht, wenn er komponiert. Die vorgestellten Komponisten sprechen mit eigenen Worten über die Quelle ihrer Geistesblitze, Inspiration und Kreativität.
Als eine Sammlung von Worten von Komponisten dieser Epoche zu genau diesem Thema kann es als wertvolles dokumentarisches Material bezeichnet werden.
Da es sich jedoch um Menschen aus dem christlichen Kulturkreis handelt, sind theologische Elemente im Hintergrund stark präsent, so dass japanische Leser einige Teile als schwer verdaulich empfinden könnten. Aber indem man diese weit gefasst als einen Sinn für den Glauben interpretiert und aus der Perspektive der Ehrfurcht vor einem transzendenten Wesen liest, glaube ich, dass es möglich ist, ihre Haltung zur Schöpfung zu verstehen.
◇
Der Untertitel lautet „Wenn Komponisten Inspiration erhalten“, was von Anfang an einen spirituellen Eindruck vermittelt. Wie der Übersetzer jedoch ebenfalls anmerkt, glaube ich, dass man das Hauptthema verstehen kann, wenn man „Reikan“ als „Inspiration“ liest. Mit anderen Worten, was ist ein „Geistesblitz“ und woher kommt er?
Brahms sagt: „Ich befinde mich in einem Trancezustand und wandere zwischen Schlaf und Wachsein. Ich bin noch bei Bewusstsein, aber genau an der Grenze, es zu verlieren, und in solchen Momenten kommen mir inspirierte Ideen. Alle wahre Inspiration kommt von Gott, und nur durch das Strahlen der inneren Göttlichkeit kann sich Gott offenbaren. Dieses Strahlen nennen moderne Psychologen das Unterbewusstsein.“
—Wenn man dies und andere ähnliche Ausdrücke liest, erinnert man sich an das, was Csikszentmihalyi den „Flow-Zustand“ nennt. Dieser Flow-Zustand begleitet in der Regel die Ergebnisse geistiger Aktivitäten, die durch hohe Konzentration oder Vertiefung erreicht werden. Er unterscheidet sich von Erregung, Rausch oder Ekstase; vielmehr ist er der gegenteilige Bewusstseinszustand.
Bezüglich des Prozesses, wie Ideen entstehen, ist „A Technique for Producing Ideas“ von James Webb Young als ein aus der Empirie abgeleiteter Leitfaden berühmt. Es scheint auch, dass die Gehirnforschung den Prozess „einer Phase des gründlichen Durchdenkens des Themas“, „einer Phase des Vergessens“ und „des Moments eines ‚Geistesblitzes‘ einer neuen Idee“ für gültig hält.
Beim Lesen dieses Buches bekam ich das Bild, dass ein Werk als glückliches Ergebnis der Verschmelzung des Flow-Zustands der Vertiefung in die anstehende Aufgabe, des gründlichen Nachdenkens und seines Vergessens (vorübergehendes Beiseitestellen) und der „hochtrainierten Fertigkeit“, die in Bereichen, die „Geistesblitze“ betonen, tendenziell geringgeschätzt wird, geboren wird.
Die Worte von Brahms: „Ich möchte, dass Sie erkennen, dass Sie sowohl Inspiration als auch handwerkliches Können benötigen, wenn Sie etwas von ewigem Wert schreiben möchten“, appellieren an die Notwendigkeit fortgeschrittener Fähigkeiten, um Inspiration zu verkörpern, neben ihrer Wichtigkeit. Wenn ich über Brahms‘ kreative Haltung nachdenke, spüre ich auch seine Frustration und seinen Kummer gegenüber der Komponistenwelt seiner Zeit.
Die Kraft dieses Buches lässt einen jedoch nicht bei solchen Eindrücken stehen. Auffallend war, dass Brahms und R. Strauss beide, mit unterschiedlichen Worten, sagten, dass „nur wenige Prozent der Komponisten mit Inspiration komponieren“.
„Nur mit dem bewussten Verstand geschrieben. Rein im Kopf geschaffen, völlig ohne Inspiration“ – solche Werke, so sagen sie, geraten schnell in Vergessenheit, und sie nennen dies als Grund für das Scheitern der Werke populärer Komponisten der damaligen Zeit. Dahinter verbirgt sich eine Ehrfurcht vor der „Kraft von etwas, das über den menschlichen Verstand hinausgeht“, die gute Musik besitzt, und vor den Wesen (Gott, die Musen), die sie hervorbringen. Vielleicht aus diesem Grund strahlen die Worte der vorgestellten Komponisten durchweg ein Gefühl der „Demut“ aus.
Es dient als Warnung davor, in die Art von Komposition zu verfallen, bei der man vorhandene Fähigkeiten nur oberflächlich einsetzt, um „etwas in Form von Musik“ zu schaffen. Gleichzeitig führt es einen zurück zu der Demut, zu spüren, dass nicht ich, der Komponist, die Musik erschaffe, sondern dass es mir erlaubt ist, an einem „Ort teilzunehmen, an dem sich die Kraft der Musik manifestiert“.
Es ist leicht, sich von dieser Art von Buch aus einer historischen oder kulturgeschichtlichen Perspektive zu relativieren und zu distanzieren, aber für mich empfand ich eine Anziehungskraft, die schwer abzuweisen, schwer loszulassen war. Wenn man über die wörtliche Bedeutung und Signifikanz von „Schöpfung“ nachdenkt, ist eine Konfrontation mit dem Bereich, den dieses Buch behandelt, vielleicht in gewisser Weise unvermeidlich.
Weitere Informationen zum Buch
Titel (Japanisch):『大作曲家が語る 音楽の創造と霊感』
Autor: アーサー・M・エイブル (著), 吉田 幸弘 (翻訳)
ISBN : 4915884686
Inhaltsverzeichnis von „Gespräche mit berühmten Komponisten“
- Anstelle eines „Vorworts“ / Einleitung / Vom Verlag / Danksagungen
- Johannes Brahms
- Kapitel 1
- Brahms und Joachim über Inspiration
- Brahms nimmt Beethoven als seinen Führer
- Wie Brahms mit Gott kommunizierte
- Brahms nimmt Mozart als sein Vorbild
- Brahms und die Anrufung der Muse
- Brahms, religiös, aber unorthodox
- Brahms zitiert Matthäus VII, 7
- Wie Lao-Tse zur Gottheit gelangte
- Kapitel 2
- Brahms und die Wunder Jesu
- Daniel Home geht in der Luft
- Daniel Homes psychische Kräfte in Paris
- Blind Tom und Zerah Colburn
- Die Biographie von Daniel Home
- Kapitel 3
- Brahms‘ Meinung zum Atheismus
- Brahms fasziniert von Tennysons Schöpfungskonzept
- Tennyson diskutiert die Schöpfung mit Darwin
- Brahms zollt Tennysons Ansicht über die unsterbliche Seele Respekt
- Kapitel 4
- Brahms interessiert sich für die Heimatstadt des Autors
- Königin Victoria und Sitting Bull
- Brahms, Tartini und der Teufel
- Brahms zollt Shakespeare und Milton Respekt
- Kapitel 5
- Warum Brahms an die Unsterblichkeit glaubte
- Brahms und Miltons Anrufung der Muse
- Brahms betont die Bedeutung der Abgeschiedenheit
- Kapitel 6
- Die meisten Komponisten mühen sich vergeblich
- Brahms kritisiert Spohrs Kurzsichtigkeit
- Brahms‘ Definition von Genie
- Was Brahms in seinen erhabenen Stimmungen sah
- Brahms, Wilamowicz und der Dieb am Kreuz
- Brahms verpflichtet zur Geheimhaltung für fünfzig Jahre
- Kapitel 7
- Wie Joachim auf Brahms‘ Zeugnis reagierte
- Joachim analysiert Brahms‘ Verleumder
- Ein Blick auf Brahms‘ Biographie
- Kapitel 1
- Richard Strauss
- Kapitel 8
- Weimar und Strauss im Jahr 1890
- Bei Strauss zu Hause
- Strauss über die Quelle der Inspiration
- Strauss hört, wie die Inspiration „Tannhäuser“ dirigiert
- Weimar – ein kulturelles Zentrum in den 1890er Jahren
- Begegnung mit der ersten Elsa und Telramund
- Eine Frau von Würde
- Die Dankbarkeit eines Komponisten
- Eine historische Szene
- Kapitel 9
- R. Strauss über Alexander Ritter
- Strauss widerspricht Emerson
- Lassens Reaktion auf „Don Juan“
- Anhörung von Strauss‘ erster Oper „Guntram“
- Als Strauss „Salome“ komponierte
- Kapitel 10
- Premiere von „Der Rosenkavalier“ in Dresden
- Premiere von „Ariadne auf Naxos“ in Stuttgart
- Strauss‘ späte Jahre
- Kapitel 8
- Giacomo Puccini
- Kapitel 11
- Begegnung mit dem Komponisten von „La Bohème“, „Tosca“ und „Madama Butterfly“
- Das Fiasko der „Madama Butterfly“-Premiere
- Puccini darüber, wie er zur Gottheit gelangte
- Puccinis Bühnenbild für „La Bohème“
- Kapitel 12
- Der Elfenbeinturm (Torre del Lago) und der Maestro
- Wie Puccini „La Bohème“ komponierte
- Puccinis glühende Hommage an Toscanini
- Musik im Widerspruch zum Libretto
- Puccini betont Trauer mit einer Dur-Tonart
- Kapitel 13
- Der Grundcharakter der Italiener
- Puccini über den Kompositionsprozess von „Tosca“
- Wie das Stück „Madama Butterfly“ Puccini faszinierte
- Kapitel 11
- Engelbert Humperdinck
- Kapitel 14
- Humperdinck über Wagners Kompositionsprozess
- Wagner holt sich seine Anregung von Shakespeare
- Humperdinck macht sich als Komponist klein
- Kapitel 14
- Max Bruch
- Kapitel 15
- Max Bruch und das g-Moll-Violinkonzert
- Max Bruch über Inspiration
- Bruches Einschätzung von Brahms
- Max Bruch in seinen späten Jahren
- Kapitel 15
- Edvard Grieg
- Kapitel 16
- Edvard Grieg und das norwegische Idiom
- Ole Bull befreit Grieg vom Einfluss von Niels Gade
- Jadassohn wird von seinen Schülern gehänselt
- Kapitel 17
- Jadassohn kritisiert Griegs Methoden
- Griegs Reaktion auf Jadassohns Kritik
- Griegs Reaktion auf Brahms‘ Ansichten
- Griegs Eindruck von Ole Bulls Spiel
- Grieg zitiert Longfellows Hommage an Ole Bull
- Grieg lehnt ein Konzert für eine Gage von 25.000 Dollar für einen einzigen Auftritt ab
- Kapitel 16
- Schlusswort
- Anmerkungen des Übersetzers / Nachwort des Übersetzers / Bibliographie / Liste der Bibelverse / Namensregister
Über den Autor
Arthur M. Abell
Der Autor, Arthur M. Abell, stammte aus einer Journalistenfamilie und wurde selbst Musikkritiker für den „Musical Courier“. 1890, im Alter von achtundzwanzig Jahren, wurde er nach Wien entsandt. Er war auch ein Amateurviolinist, sprach fließend Deutsch und Italienisch und pflegte Freundschaften mit vielen Künstlern und Musikkritikern in Boston und New York. Darunter waren Arthur Nikisch, Dirigent des Boston Symphony Orchestra, Walter Damrosch, Dirigent der New York Philharmonic, und Philip Hale, ein bekannter Musikkritiker an der Ostküste.