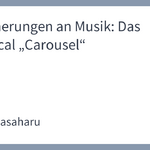(Erstveröffentlichung am 14. Juni 2006)
Ich habe kürzlich Witold Lutosławskis (1913-1994) „Interludium“ aus seiner Symphonie Nr. 4 (NAXOS-Einspielung) wieder gehört.
Nachdem ich kürzlich im Zusammenhang mit der Neoromantik über Rautavaara geschrieben habe, höre ich mir einige meiner NAXOS-CDs erneut an. Dabei hat mich Lutosławski besonders fasziniert.
Lutosławski ist ein Komponist, der dafür bekannt ist, Musik durch die Methode der kontrollierten Aleatorik zu schaffen, berühmt in Werken wie seiner Symphonie Nr. 3, der „Kette“-Reihe (Chain series) oder den „Jeux vénitiens“ (Venezianische Spiele). Persönlich mag ich seine 3. Symphonie sehr.
Man kann nicht umhin, beeindruckt zu sein von dem „stolpernden, überstürzten Rausch“, der durch die Wucht und Plötzlichkeit des „Da-da-da-da!“-Motivs entsteht. Dies, verwoben mit der „kontrollierten Aleatorik“, erzeugt eine „Transformation der Klangfülle und der Dichte der Textur“. Und die meisterhafte Konstruktion, die die innere Spannung des Hörers packt und ihn vorantreibt, ist bewundernswert.
Ein weiterer Reiz liegt in seinem einzigartigen Harmonieverständnis, das man als „bitter und kalt, aber mit einer samtig feinen Textur“ beschreiben könnte. Das hier besprochene „Interludium“ ermöglicht es, diesen Geschmack ausgiebig zu genießen.
Die Streicher, die einen „langsamen Wechsel von weiträumigen Klängen“ darbieten, bilden das Grundgewebe des Stücks. Dahinein treten fragmentarische Phrasen, wie seufzende Selbstgespräche, mit einem Gefühl von Nähe und Ferne auf und verschwinden wieder.
Die Art und Weise, wie diese Tiefenwirkung erzeugt wird, ist exquisit: Der naive (oder schlichte) Ausdruck der Holzbläser erscheint greifbar nah, eine Streichergruppe scheint aus weiter Ferne aufzutauchen, oder auch umgekehrt (ein naiver Holzbläser aus der Ferne) – eine subtile Vielfalt.
Dieser Stil ist eines von Lutosławskis Markenzeichen; teilweise findet man ihn in vielen seiner Werke, und ein einfaches, aber wirkungsvolles Beispiel dafür ist im ersten seiner „Drei Postludien“ zu hören.
Was das „Interludium“ betrifft, so ist besonders der Moment um 3:37 Minuten hervorzuheben: ein zart duftender, süßer Streicherklang, gefolgt von einer absteigenden Posaunenlinie und dem Klang von Röhrenglocken. Nachdem dieser Punkt als struktureller Höhepunkt erreicht ist, beginnt die Musik einen sanften Weg der Verengung und Auflösung (buchstäblich eine Reduktion der Töne).
Dieses „Interludium“ wurde konzipiert, um bei Konzerten „Kette 2“ (Chain 2) und die „Partita“ zu verbinden, aber ich persönlich würde eher empfehlen, es für sich allein zu genießen.
Ich möchte mich zwar nicht aus einer – sagen wir – „pharmakologischen“ Perspektive des Musikhörens äußern, aber es erweckt beim Hörer den Eindruck eines „stillen Erwachens“, das sich von bloßer Entspannung unterscheidet. Und es vermittelt das Gefühl eines weiten, geschlossenen Raumes.
Übrigens hatte ich die CD, auf der sich dieses Stück befindet, ursprünglich wegen der Symphonie Nr. 4 gekauft, sodass ich das „Interludium“ nur einmal flüchtig gehört hatte. Als ich es nun, beeinflusst durch meine Beschäftigung mit Rautavaara, erneut hörte, war ich von seiner musikalischen Welt tief beeindruckt. Diese Erfahrung ließ mich auch darüber nachdenken, wie sehr der Zustand des Hörers und seine Hörhaltung die Wahrnehmung beeinflussen können, da ich beim ersten Hören nicht darauf reagiert hatte.
Titel (Japanisch):『Symphony No.4』
Autor: Witold Lutoslawski (アーティスト)
ISBN : B000001464