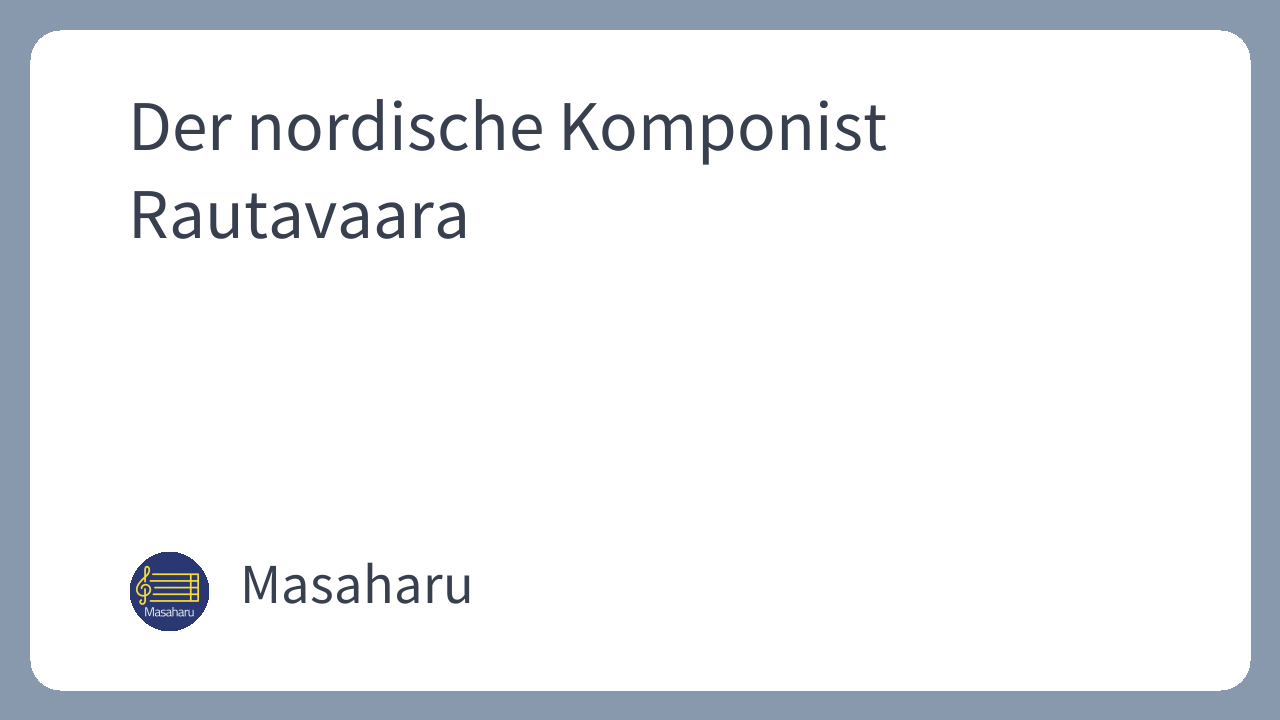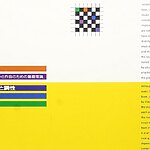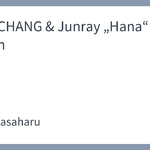(Erstveröffentlichung am 9. Juni 2006)
Ich habe Symphonien Nr. 3, 7 und 8, Klavierkonzerte Nr. 2 und 3 und anderes von Einojuhani Rautavaara (1928- ) gehört. Die Website von NAXOS bietet reichhaltige Hörproben, was praktisch ist, um unbekannte Komponisten kennenzulernen. Man kann entweder basierend auf dem allgemeinen Ruf suchen oder so hören, als würde man zufällig eine Enzyklopädie aufschlagen.
So begann ich, Neo-Romantik, Neo-Simplizität und Minimalismus zu erkunden und folgte zunächst Informationen über Komponisten wie Pärt, Górecki und Adams, und dabei stieß ich schließlich auf Rautavaara.
Aufgrund meiner Unkenntnis wusste ich nicht, dass dieser Rautavaara wohl der bekannteste Komponist aus den nordischen Ländern ist. Darüber hinaus ist seine Klangwelt ziemlich, oder vielmehr, ganz nach meinem Geschmack. Während ich mir wünschte, ich hätte ihn früher gekannt, empfinde ich gleichzeitig eine komplexe Stimmung, indem ich denke, dass es vielleicht gut war, dass ich Abstand vom „Boom der 7. Symphonie“ halten konnte, da ich Trends nicht mag. Außerdem interessierte mich Rautavaaras persönliche musikalische Geschichte mehr als seine Position in musikgeschichtlichen Strömungen wie Neo-Romantik oder Neo-Simplizität.
Er durchlief um die 1970er Jahre eine beachtliche romantische Stiländerung. Doch selbst in den strengen seriellen Klängen seiner frühen Werke spüre ich Harmonien, die den Geschmack des heutigen Rautavaara haben. Das lässt mich denken, dass er auf gute Weise eine hartnäckige Sensibilität entwickelt hat. Übrigens ist es etwas, das ich auch empfand, als ich zuvor Musik von Sculthorpe hörte: Wenn ich einem Komponisten gegenüberstehe, der lyrische oder persönliche Romantik ausdrückt, verspüre ich den Drang, seinen kompositorischen Werdegang zu verfolgen. Vielleicht ist dies ein Verlangen, das aus meinem eigenen dringenden Wunsch nach musikalischer Selbsterneuerung entsteht.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich viele weitere Werke Rautavaaras sowie die Werke anderer nordischer Komponisten kennenlernen.
Nachtrag: Von Serialismus zur Tonalität ~ Was darunter fließt
(Nachtrag hinzugefügt am 15. Mai 2025)
Um es noch einmal zu betonen: Wenn man an Rautavaara denkt, haben viele Menschen vielleicht das Bild eines relativ zugänglichen zeitgenössischen Komponisten, bekannt für seine späteren Werke, die Vogelstimmen einbeziehen und einen großartigen, schönen Klang haben. Wenn man jedoch seine Karriere zurückverfolgt, gab es in seinen frühen Jahren eine Phase, in der er tief in die Zwölftontechnik und serielle Musik involviert war. Die oberflächliche musikalische Sprache seiner frühen und späten Werke unterscheidet sich so sehr, dass man auf den ersten Blick kaum glauben würde, dass sie vom selben Komponisten stammen. Während seine frühen seriellen Werke eine gewisse Strenge und Härte besitzen, weisen seine späteren Werke klare Melodien und Akkorde auf und sind voller lyrischer und weiträumiger Klänge.
Betrachten wir, warum sich sein Stil so dramatisch geändert hat und ob es eine gemeinsame „Rautavaara-heit“ gibt, die zwischen den Werken dieser beiden unterschiedlichen Perioden fließt.
Wenn man Rautavaaras Stiländerungen aus der Perspektive betrachtet, wie er bestimmte „Techniken“ und „Theorien“ für seinen eigenen Ausdruck auswählte und meisterte, lassen sich meiner Meinung nach interessante Erkenntnisse gewinnen. Zum Beispiel können folgende Punkte als Gemeinsamkeiten hinter der großen Verschiebung von der frühen seriellen Periode zur späteren tonalen Periode genannt werden.
A. Starkes Engagement für Klang und Fähigkeit zur Konstruktion von Textur
Serielle Technik ist eine Methode, Tonhöhe, Rhythmus usw. strikt basierend auf Zahlenreihen zu komponieren. Doch selbst in seiner frühen Periode schien Rautavaara ein starkes Interesse nicht nur an mechanischer Manipulation zu haben, sondern am Klang selbst, der daraus entstand. Die Textur, die durch seine einzigartige Schichtung von Klängen und Kombination von Instrumenten entsteht, ist schon in seiner frühen Periode charakteristisch. Dies gilt auch für seine späteren Werke; obwohl er klare Akkorde verwendet, ist Rautavaaras Orchestrierung immer einzigartig und schafft Klangräume mit Transparenz und Tiefe. Vielleicht führte die Sensibilität für den akribischen Umgang mit Klangpartikeln und -schichten, die in der frühen Periode entwickelt wurde, zur reichen Textur der späteren Periode.
B. Formbewusstsein und Fähigkeit zur Konstruktion des Gesamtwerks
Rautavaaras Werke, auch die mit unterschiedlichen oberflächlichen Klängen, haben oft ein durchgängig starkes Formgefühl. Seine Musik fühlt sich konstruiert an, basierend auf einer bestimmten „Ordnung“ und „Logik“. In der seriellen Periode unterstützte die Tonhöhenreihe diese Logik, aber in der späteren Periode wählte er freiere Formen und Strukturen, die seinem eigenen inneren musikalischen Fluss folgten. Die Fähigkeit, die Integrität des Gesamtwerks aufrechtzuerhalten und es wie ein zusammenhängendes Ganzes klingen zu lassen, ist jedoch seit der frühen Periode konsistent. Ich glaube, dies zeigt eine grundlegende kompositorische Haltung, musikalische Notwendigkeit aus chaotischem Klang zu suchen.
C. Ständige Sehnsucht nach „Mystik“ und „Transzendenz“
Eines der wichtigen Elemente bei der Diskussion von Rautavaaras Werken ist die mystische und etwas transzendente Atmosphäre, die konstant durch seine Musik fließt. Selbst in seinen frühen seriellen Werken gibt es Momente, die einen introspektiven und kosmischen Klang hervorrufen, nicht nur eine zufällige Ansammlung von Klängen. In seinen späteren Werken wird diese Mystik durch die Verwendung schöner Melodien und großer Akkorde so ausgedrückt, dass sie direkter im Herzen des Hörers resoniert. Die Themen reichen weit, von der Verschmelzung von Mensch und Natur (Vögel) in „Cantus Arcticus“ bis zur introspektiven und mythischen Weltanschauung in seinen Opernwerken. Unabhängig von der Technik kann gesagt werden, dass Rautavaara stets Musik anstrebte, die die spirituelle Welt jenseits des Alltags oder den Ursprung der Welt berührt.
D. Latente oder manifeste Melodiebewusstsein
In der seriellen Musik ist „Melodie“ im traditionellen Sinne oft fragmentiert. Doch in Rautavaaras frühen Werken ist es möglich, eine Art melodische „Präsenz“ innerhalb der Tonhöhenbeziehungen zu spüren, die aus der Tonhöhenreihe extrahiert werden. In seinen späteren Werken entfaltet sich diese Melodizität vollständig und wird zu einem angenehmen „Lied“ für das Ohr des Hörers. Seine Melodien sind jedoch nicht nur leicht zu verstehen; sie besitzen ein einzigartiges Gefühl des Schwebens und unvorhersehbare Schönheit. Dies deutet darauf hin, dass das in der frühen Periode kultivierte scharfe Gefühl für Tonhöhenbeziehungen mit seiner einzigartigen Melodik in der späteren Periode verbunden sein könnte.
◇
──So betrachtet, scheint Rautavaaras Stiländerung nicht bloß ein Folgen von Trends oder das Anbiedern an das Publikum zu sein, sondern das Ergebnis der flexiblen Auswahl verschiedener Techniken als Werkzeuge zur Verwirklichung seiner eigenen inneren musikalischen Vision. Vielleicht waren serielle Technik und tonale Sprache für ihn einfach unterschiedliche Mittel, um die Essenz der Musik, die er verfolgte – wie „Klang“, „Form“ und „Mystik“ – zu gestalten.
Rautavaaras Werk lehrt uns aufs Neue die Bedeutung, auf die zugrunde liegende Gedankenwelt und das ästhetische Empfinden eines Komponisten zu hören, anstatt sich vom oberflächlichen Stil fesseln zu lassen, um zu verstehen, was der Komponist auszudrücken versucht. Indem man seine frühen und späten Werke hört und vergleicht, kann man die Individualität des Komponisten spüren, die über technische Unterschiede hinausgeht, und die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten, die Musik besitzt.