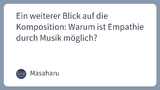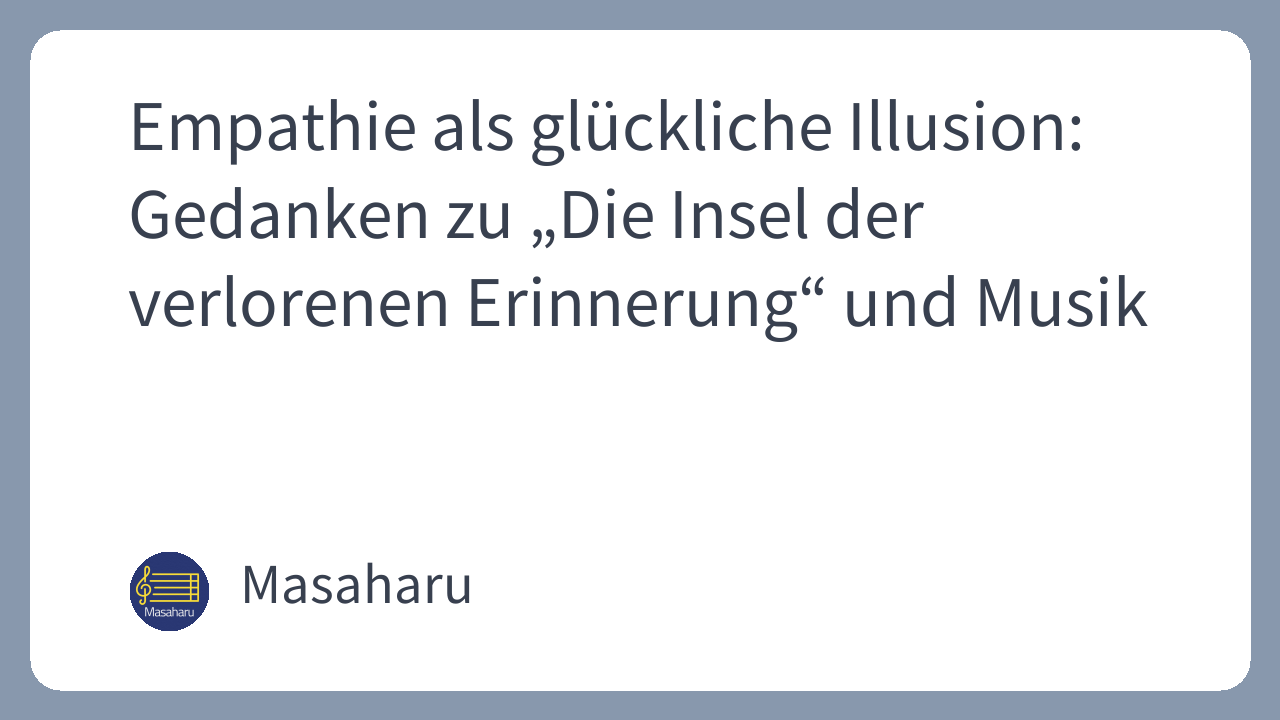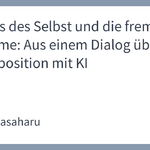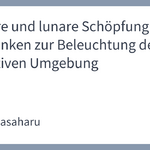Kürzlich habe ich die Lektüre von Yoko Ogawas Roman „Die Insel der verlorenen Erinnerung“ beendet.
Das Leseerlebnis war für mich etwas Besonderes. Ich habe mich nicht stark in die Charaktere hineinversetzt oder die Szenen lebhaft vor meinem inneren Auge gesehen. Stattdessen war ich einfach nur still und fasziniert davon, der Geschichte zu folgen – eine ruhige Erfahrung. Dennoch fühlte ich mich erfüllt, als ich die letzte Seite schloss, denn ich hatte das Gefühl, das Gesamtbild dieser Welt erfasst zu haben. Es war eine Art „stille Gewissheit“.
Doch dies ist wahrscheinlich nicht mehr als eine „glückliche Illusion“. Denn es ist unmöglich, dass ein externer Leser eine Welt vollständig begreift, die selbst die Charaktere der Geschichte nicht gänzlich verstehen. Rückblickend erkenne ich, dass das „Gesamtbild“, das ich zu erfassen glaubte, weniger etwas vom Autor Vorgegebenes war, sondern vielmehr ein Bild, das durch die Resonanz meiner eigenen Erinnerungen, Erfahrungen und Gefühle mit den Fragmenten der Erzählung entstand. Es war sozusagen ein Bild, das sich still in meinem eigenen Geist kristallisierte. Die Zufriedenheit in diesem Moment rührte daher, dass meine eigene innere Welt daran beteiligt war.
Diese Leseerfahrung deckt sich mit meinen Vorstellungen über den „Mechanismus der Empathie in der Musik“ (siehe verwandte Artikel). Empathie in der Musik wird oft fälschlicherweise so verstanden, dass der Hörer die Gefühle und Absichten des Komponisten direkt nacherlebt. In Wirklichkeit können wir jedoch niemals die vollständige Absicht des Komponisten kennen, und es gibt keine Möglichkeit, sie zu überprüfen. Trotzdem entwerfen wir beim Musikhören unser eigenes Gesamtbild und finden darin Empathie.
Musik ist eine zeitbasierte Kunst, deren Gesamtheit sich nicht in einem einzigen Augenblick erfassen lässt. Die Leerräume innerhalb eines Stücks, wie Pausen und Nachhall, regen die Vorstellungskraft des Hörers aktiv an. Wäre die Musik ein ununterbrochener Klangstrom ohne Lücken, würde sie zu einer Informationsflut und käme einem bedeutungslosen Geräusch nahe. In den Momenten der Stille fragen wir uns: „Was wird als Nächstes kommen?“ oder „Welche Bedeutung kann ich hier finden?“. Dann nutzen wir unsere eigene Sensibilität, rufen sogar Umgebungsgeräusche und vergangene Erinnerungen wach und kristallisieren so unser ganz eigenes musikalisches Bild.
Dieser Prozess ähnelt dem Bestreben, „ungeschriebene Worte“ zwischen den Zeilen eines Romans zu lesen. Der vom Komponisten bewusst oder unbewusst geschaffene Freiraum weckt die Sensibilität des Hörers und ermöglicht es ihm, das „Gesamtbild“ selbst zu rekonstruieren. Dieses entstandene Bild ist, streng genommen, nicht der ursprüngliche Entwurf des Komponisten. Doch wenn wir es als „meine Wahrheit“ akzeptieren, erfahren wir echte Empathie. Man mag es eine Illusion nennen, aber vielleicht ist gerade diese „glückliche Illusion“ eine der tiefsten Freuden des Kunsterlebnisses.
So verstehe ich die „stille Gewissheit“, die ich nach der Lektüre von „Die Insel der verlorenen Erinnerung“ empfand. Ich habe nicht die Absicht der Autorin vollständig verstanden, sondern durch die Auseinandersetzung mit dem Werk meine eigene Bedeutung zugewiesen, wodurch sich „mein eigenes Gesamtbild“ herauskristallisierte. Ich glaube, daher rührte meine Zufriedenheit.
Dasselbe Prinzip gilt für die Komposition. Der Prozess der Auswahl, Anordnung und Gestaltung von Materialien zu einem musikalischen Fluss involviert die persönliche Sensibilität und den Willen des Komponisten. Das so entstehende Werk wird aufseiten des Hörers zu einem weiteren „Gesamtbild“, und in der Beziehung zwischen beiden entsteht eine neue Form der Empathie.
Letztendlich sind Lesen, Musikhören und Schaffen allesamt Tätigkeiten, die von unserem grundlegenden Wunsch angetrieben werden, „Bedeutung zu verleihen“. Und obwohl dieses Bestreben eine (glückliche) Illusion sein mag, verbindet es Menschen und lässt Kunstwerke über die Zeiten hinweg weiterleben. Das, so glaube ich, ist die geheimnisvolle und kostbare Kraft der Kunst.
Verwandte Artikel