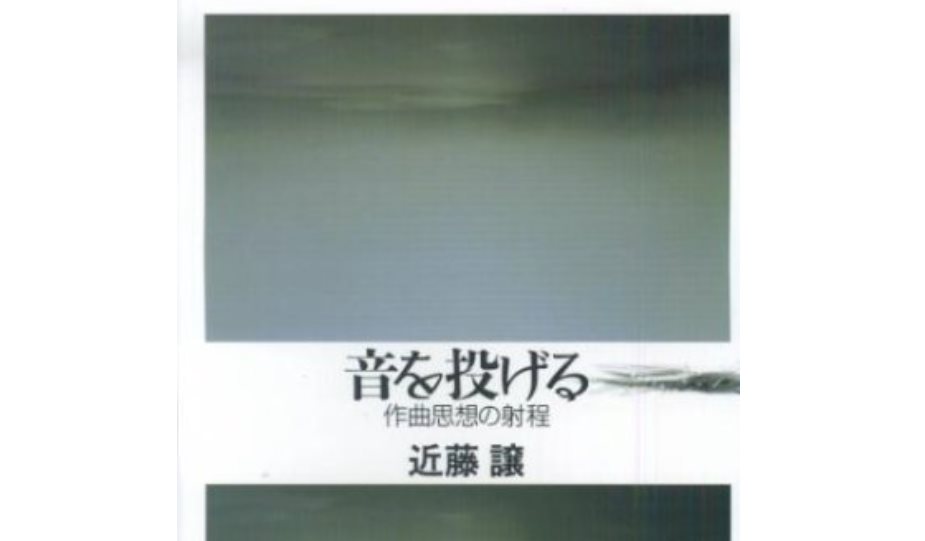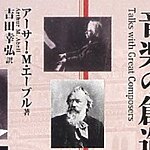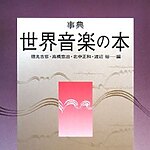(Erstveröffentlichung am 4. Januar 2009)
Der Komponist Jo Kondo, der durch seine einzigartige Kompositionspraxis der „Musik der Linien“ unverwechselbare Werke veröffentlicht und gleichzeitig einen fundamental fragenden Blick auf die Musik richtet. Dieses Buch ist eine Sammlung seiner kritischen Aufsätze, die über einen Zeitraum von zwanzig Jahren geschrieben wurden.
Bei einer Aufsatzsammlung, die einen so langen Zeitraum umfasst, würde man eine gewisse Breite oder Schwankung in Inhalt und Argumentation erwarten, aber dieses Buch vermittelt einen überraschend geschlossenen Eindruck. Man könnte sagen, das liegt daran, dass der Standpunkt seines Problembewusstseins fest verankert ist.
Mit „Standpunkt“ ist nicht gemeint, dass er sich eng begrenzt, sondern man spürt vielmehr die Absicht, von dort aus weit in die Ferne zu blicken. Zum Beispiel greift er in „1. Klang und Musik“ die Musiktheorie von John Cage auf, weitet seine Diskussion aber letztendlich auf die Kommunikationstheorie aus, weist auf „die Krankheit der Unmöglichkeit intersubjektiver Kommunikation“ hin und geht auf das ein, was Cages Musik symbolisiert.
Andererseits beginnt „7. Musik nachahmen“ damit, dass der Autor als Oberschüler den Wunsch hegte, zu komponieren, und erzählt Episoden aus der Zeit, als er bei dem Komponisten Yoshio Hasegawa studierte. Hier schreibt er in ehrlicher Prosa über den Erwerb kompositorischer Fähigkeiten und expressiver Kraft, aus einer pädagogischen Perspektive und im Lichte seiner eigenen Erfahrungen.
Es gibt eine charmante Episode, in der der Oberschüler Kondo von Herrn Hasegawa gefragt wurde: „Sie wollen also komponieren? Dann zeigen Sie mir doch mal Stücke, die Sie geschrieben haben“, worauf er nur verlegen antworten konnte: „Ich habe nichts, was ich Ihnen zeigen könnte“, da er noch nie ein Stück geschrieben hatte. Obwohl charmant, fühlt es sich auch wie der Eingang zu einer „großen Frage“ an, die als Problemstellung bezüglich Komposition und Bildung tief verwurzelt ist.
Die Diskussion geht dann auf den Unterschied zwischen dem „Lernen“ (習う, narau) und dem „Nachahmen/Emulieren“ (倣う, narau) von Komposition und die Bedeutung der Nachahmung ein. Dieser Inhalt erinnert unweigerlich an das japanische Sprichwort „Lernen (manabu) kommt von Nachahmen (manebu)“.
Am Ende dieses Kapitels stellt der Autor fest: „Komposition kann weder gelehrt noch gelernt werden. Nur durch Nachahmung kann man die Komposition kennenlernen.“ Ich hoffe, Sie lesen das Buch selbst, um die Bedeutung dieser Worte aus ihrem vollständigen Kontext zu erfassen.
Auf diese Weise ist dieses Buch eine Aufzeichnung der Entwicklung von Herrn Kondos Problembewusstsein und ein Dokument seines konsequenten Blicks.
Weitere Informationen zum Buch
Titel (Japanisch):『音を投げる 作曲思想の射程』
Autor: 近藤 譲 (著)
ISBN : 4393935063
Inhaltsverzeichnis von „Klänge werfen: Die Reichweite des kompositorischen Denkens“
- Teil I: Klang, Musik, Worte
- 1. Klang, Musik
- 2. Musik als Sprache
- 3. Ein Ohr für das Transzendente – Mystik und mystische Musik
- 4. Worte, Struktur und Bedeutung in der Musik – Zur Überwindung des Denkens des 18. Jahrhunderts
- Teil II: Die Form der Zeit
- 5. Der Diskurs der Musik – Versuch einer Definition
- 6. Die Welt als Gefäß – Die Art von Raumzeit in Cages Musik
- Teil III: Tradition, Bildung
- 7. Musik nachahmen
- 8. Über Tradition
- 9. Der zeitgenössische Komponist und die „Tradition“ (Vortrag)
- Teil IV: Zwei verschiedene Themen
- 10. Der Niedergang des „Schreibens“
- 11. Die Rolle der Musikkritik
Über den Autor
Jo Kondo (Kondo Jo)
Komponist. Geboren 1947. Absolvent der Kompositionsabteilung der Tokyo University of the Arts. Er hielt sich auf Einladung der JDR 3rd Foundation, des British Council etc. in New York, London und anderen Städten auf. Er wurde als Themenkomponist zu vielen internationalen Musikfestivals im In- und Ausland eingeladen und hat Kompositionsaufträge von verschiedenen wichtigen Institutionen und Aufführungsgruppen in Europa und den USA erhalten. Nach seiner Tätigkeit als Professor an der Elisabeth University of Music ist er Professor an der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften der Ochanomizu-Universität. (Zitiert aus diesem Buch)