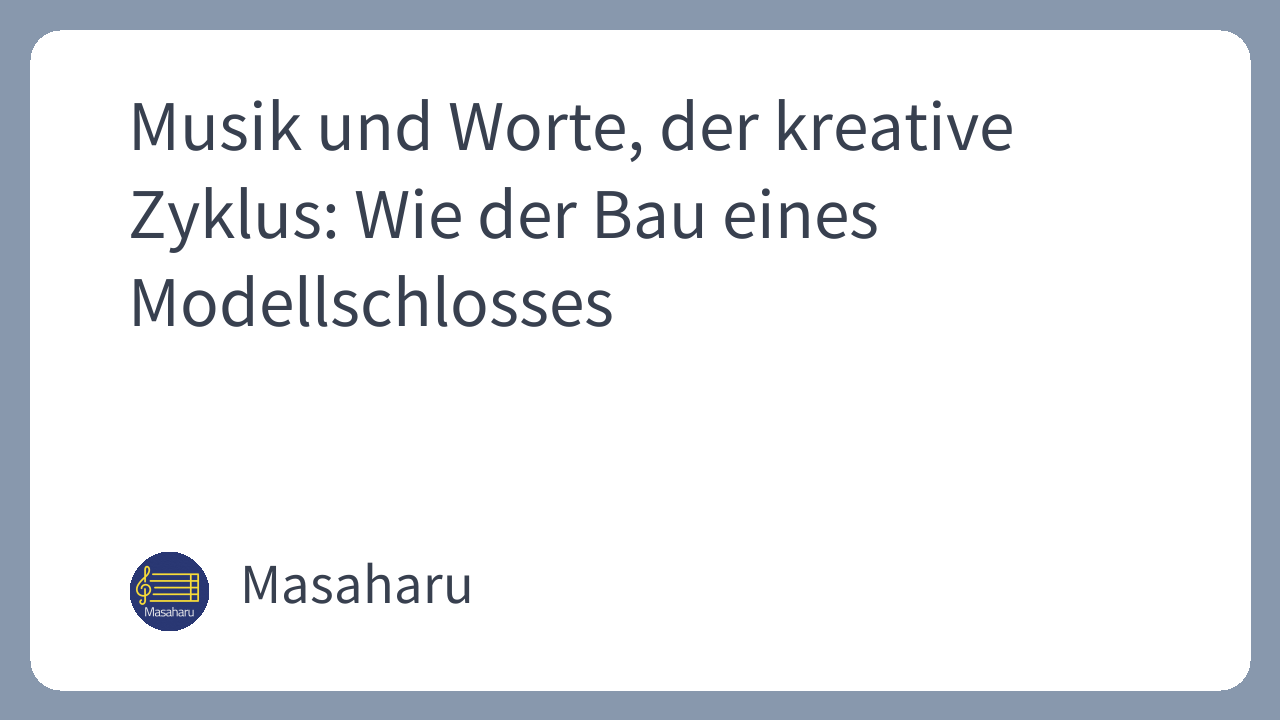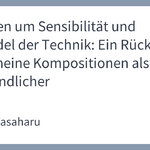Welche Gedanken hegt ein Musikschaffender, wenn er „über Musik“ schreibt?
In meinem Fall ist es so, dass ich die unübersetzbare, gewaltige Kraft spüre, die ich vor der Musik empfinde – etwas, das sich im Grunde nicht in Worte fassen lässt. Gerade weil ich das weiß, wage ich es, Worte zu spinnen.
Es ähnelt vielleicht dem Versuch, nicht das gleißende Licht selbst zu ergreifen, sondern vielmehr die Konturen des Schattens, den dieses Licht wirft, sorgfältig nachzuzeichnen.
Was ist Musik? Was ist Komposition? Indem man diese Fragen stellt und versucht, sie zu verbalisieren, wird man paradoxerweise an einen Punkt geführt, an dem man die inhärente Nicht-Verbalsierbarkeit der Musik selbst anerkennen muss. Meine „Texte über Musik“ könnte man als Skizzen oder Abstraktionen beschreiben, die gezeichnet wurden, während ich am Abgrund der gewaltigen Existenz der Musik stehe.
Wittgenstein sagte einst: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“ Doch wie der Kunstanthropologe Satoshi Nakajima andeutet, können wir vielleicht, während wir über das Unsagbare schweigen, gleichzeitig die „Unsagbarkeit des Unsagbaren“ verbalisieren.
Am Rande des Schweigens zu stehen, zu fragen, warum es ein Abgrund ist, und zu sprechen. Ich glaube, auch das ist eine aufrichtige Haltung für jemanden, der schöpferisch tätig ist.
Für mich ist die musikalische Erfahrung, die ich durch das Komponieren gewinne, ein einzigartiges Erlebnis, das mich die unabweisbare Kraft und die Qualia (Textur) der Musik spüren lässt. Die Worte, die von dieser Erfahrung inspiriert werden, nehmen den Charakter einer Art sekundären Schöpfung an.
Der so entstandene Text ist der Musik nicht einfach untergeordnet, geschweige denn eine Umwandlung von ihr. Er ist vielmehr wie ein „Satellit“, der von der Schwerkraft des Planeten Musik eingefangen ist, aber seine eigene Umlaufbahn zieht – ein eigenständiges Schöpfungswerk.
Auf diese Weise etabliert sich dieser Akt der Verbalisierung schließlich als einer meiner eigenen kreativen Akte. Ich lausche der Musik, betrachte sie aufmerksam, kombiniere die daraus entstehenden Worte und füge sie zusammen, um den Text als einzelnes Objekt zu konstruieren (komponieren).
Musik komponieren, Texte schreiben und diese Schöpfungen unter der eigenen Persönlichkeit ansammeln, um eine einzige *Form* zu bilden. Dieses ganze Unterfangen ist für mich erfüllt von einer Begeisterung, die dem Bau eines „Modells einer Burg“ gleicht und meine gesamte kreative Tätigkeit symbolisiert.
Ich bin fasziniert von dieser meta-kreativen Aktivität, bei der man das ästhetische Bewusstsein und die Besessenheit, die in den Details dieser Form wohnen, die Harmonie und die Verzerrungen des Ganzen sowie die einzigartigen Qualia, die durch diese Form hervorgerufen werden, wahrnehmen und genießen kann.
Wenn man weiter darüber nachdenkt, kann man dies als den Aufbau eines „Systems zur Beobachtung des eigenen kreativen Prozesses“ von außen betrachten. Anders gesagt, durch die Kombination von Musik und Worten – qualitativ unterschiedlichen Ausdrucksformen – könnte es zu einem „experimentellen Beobachtungsapparat“ zur Steigerung der eigenen Kreativität werden.
In diesem Apparat gibt es zwei Versionen meiner selbst. Die eine ist der „Praktiker“, der Musik komponiert. Die andere ist der „Beobachter“, der das Verhalten des Praktikers aus einer Meta-Perspektive betrachtet, es aufzeichnet und nach der nächsten kreativen Richtung und Nahrung sucht.
Dabei bemerkt man, dass dieses System beginnt, die Züge eines lebenden Organismus anzunehmen. Das biologische Konzept der „Autopoiesis“ (Selbstproduktion) könnte hier gut passen.
Die Praxis des Musikmachens wirft Fragen auf, die eine Verbalisierung erfordern, wie zum Beispiel: „Was habe ich geschaffen (was ist das)?“ Und der beobachtende Akt des „Verbalisierens“ ermöglicht eine Selbstobjektivierung und führt zur Bereitstellung neuer Perspektiven und Energie für die nächste Musik.
In mir ist es so, dass Musik Worte hervorbringen kann und Worte zu einem Dünger werden können, der den Boden für die Musikproduktion bereichert. Durch diesen Kreislauf produziert das System kontinuierlich seine eigenen Komponenten, ähnlich einem autonom angetriebenen Lebewesen.
Und wie die Metapher des „Lebewesens“ andeutet, gibt es einen „Gesundheitszustand“ – gut oder schlecht. Konkret bedeutet das in meinem Fall, dass ich meist ein ungesundes Gefühl habe, wenn ich mich zu sehr auf die verbale Tätigkeit als Beobachter verlege.
Dieses Bewusstsein ist wahrscheinlich ein Alarmsignal dafür, dass die Praxis (die Musikproduktion), die die fundamentale Energie des Systems sein sollte, vernachlässigt wird.
Es ist ein Warnsignal, dass die kreative Energie nicht zirkuliert. Es ist ein Unbehagen, wie eine Verschwendung, das eigene kreative Potenzial nicht auszuschöpfen, ein Zeichen, dass der Blutkreislauf des Systems stagniert und seine Lebenskraft schwindet.
Ich wünsche mir vor allem, jemand zu sein, der sich der Musik stellt und ihr Gestalt gibt, und ich glaube, das ist meine Art, Wert zu vermitteln. Deshalb empfinde ich eine gewisse Leere, wenn ich in eine Situation gerate, in der nur Worte ohne begleitende Praxis erschöpft werden. Es ist abgedroschen, aber ich schätze, ich möchte Praktiker sein, bevor ich Kritiker bin.
Dieses Gefühl und diese Gedanken sind wohl eine wichtige Achse in meinem eigenen Schaffen. Deshalb empfinde ich vielleicht eine Art Frustration oder Dissonanz mit mir selbst, wenn eine große Kluft zwischen dem, was produziert wird, und den Worten, die gesprochen werden, entsteht.
Gleichzeitig ist dieser Blick ständig auf mich selbst gerichtet. Die Frage: „Entfernt sich das ‚Ich‘, das Worte erschöpft, von dem ‚Ich‘, das Praktiker ist?“ wirkt ständig als innere Andersartigkeit (ein richterliches Auge), das mich stützt und zugleich ermahnt.
Natürlich gibt es im kreativen Prozess Zeiten, in denen jeder innehalten, zweifeln und tief in den Wald der Worte eintauchen muss. Das ist keineswegs verschwendete Zeit, und das sehe ich auch so, wenn ich auf mich selbst zurückblicke.
Dennoch hege ich den Wunsch, mich eher auf die Seite der Praxis zu stellen – etwas zu schaffen, und sei es noch so unbeholfen –, als Romantik in der Existenz als „Dichter, der nicht vorträgt“ oder „Maler, der nicht malt“ zu finden.
Auf diese Weise meine Gedanken zu verbalisieren, ist selbst Teil meines kreativen Systems und auch ein „Mechanismus zur Gesundheitsprüfung“ für diese Seinsweise. Und auch jetzt spüre ich, wie der Blick des Beobachters auf mich gerichtet ist, während ich diesen Text verfasse.
Was ich hier dargelegt habe, ist wahrscheinlich etwas, das viele Kreative schon einmal gespürt haben, aber indem ich es auf meine eigene Weise verbalisiert habe, habe ich das Gefühl, dass meine eigene Existenzweise wieder ein wenig klarer geworden ist.
Die Zeit des Nachdenkens im Meer der Worte ist für mich ein wichtiger Nährboden für meine nächste Schöpfung und Selbstwartung. Aber um den kreativen Kreislauf nicht stagnieren zu lassen, ist es wohl wichtig, sich vorzustellen, das Ganze, einschließlich dieses Denkprozesses, kontinuierlich in Bewegung zu halten.